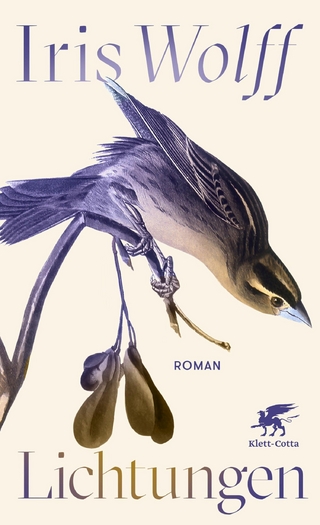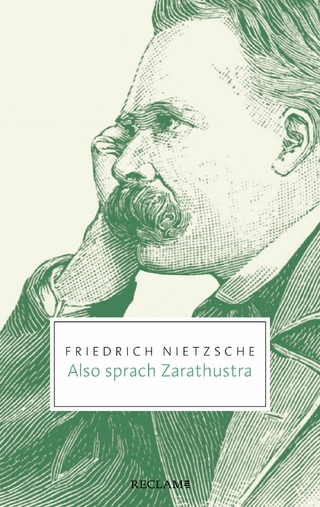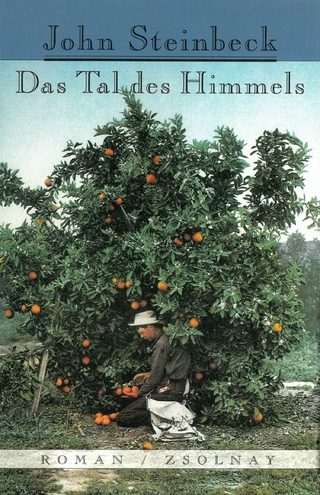Der Mensch ist gut (eBook)
396 Seiten
Aufbau digital (Verlag)
978-3-8412-1099-9 (ISBN)
Leonhard Frank wurde am 4. September 1882 in Würzburg geboren. Sein Vater war Schreiner, er selbst ging zu einem Schlosser in die Lehre, arbeitete als Chauffeur, Anstreicher, Klinikdiener. Talentiert, aber mittellos, begann er 1904 ein Kunststudium in München. 1910 zog er nach Berlin, entdeckte seine erzählerische Begabung und verfaßte seinen ersten Roman, 'Die Räuberbande', für den er den Fontane-Preis erhielt. Im Kriegsjahr 1915 mußte er in die Schweiz fliehen: Er hatte Zivilcourage gezeigt und handgreiflich seine pazifistische Gesinnung kundgetan. Hier schrieb er Erzählungen gegen den Krieg, die 1918 unter dem berühmt gewordenen Titel 'Der Mensch ist gut' erschienen. Von 1918 bis 1933 lebte er wieder in Berlin, nun schon als bekannter Autor. 1933 mußte er Deutschland erneut verlassen, diesmal für siebzehn Jahre. Die Stationen seines Exils waren die Schweiz, England, Frankreich, Portugal und zuletzt Hollywood und New York. 1952, zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus den USA, veröffentlichte er den autobiographischen Roman 'Links wo das Herz ist'. Leonhard Frank, 'ein Gentleman, elastisch, mit weißen Haaren, der in seinem langen Leben alles gehabt hat: Hunger, Entbehrung, Erfolg, Geld, Luxus, Frauen, Autos und immer wieder Arbeit' (Fritz Kortner), starb am 18. August 1961 in München.
I. Der Vater
Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen,
daß ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet?
Es ist schon die Axt an die Wurzel gelegt.
Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt,
wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Ev. Matth. Kap. III
Robert war Servierkellner in einem deutschen Hotelrestaurant. Gewöhnlich. Blond. Und wenn er, in devoter Verbeugung erstarrt, vor dem Gaste stand und eine Bestellung entgegennahm, kroch der Gedanke durch sein Gehirn: jeder andere Beruf verträgt sich eher mit der Menschenwürde.
Auf ihn wirkte das hingeschobene Trinkgeld wie eine Ohrfeige, für die man sich bedanken mußte. Und wenn das Trinkgeld von einem Gaste kam, der ärmer als der Empfangende war, stieg aus Roberts verletzter Menschenwürde sichtbar die Verachtung empor, steigerte sich manchmal zu Rachsucht und Frechheit. Es kam vor, daß Robert solch einem Gaste das Trinkgeld zurückschob. Vornehmen Gästen Kredit zu gewähren, war ihm eine Erlösung.
Im Jahre 1894 bekam seine Frau den lange vergeblich erwarteten Sohn. Und Roberts Liebe stürzte sich auf dieses Kind. Das bekam alles: ein Kinderzimmer, sterilisierte Kindermilch, einen federnden Kinderwagen, einen weißlackierten Stall, Hampelmänner. Später Dampfmaschinchen, Eisenbahnen, Luftballons, Trommeln, Säbel, Schießgewehrchen, Bleisoldaten. Später ein Spazierstöckchen, einen Matrosenanzug mit einer Mütze, auf der stand »S. M. S. Hohenzollern«, einen rindsledernen Bücherranzen, eine Rechenmaschine mit roten und weißen Kugeln, einen polierten Griffelkasten.
Der Sohn bekam Geigenstunden, mußte Klavierspielen lernen. Und durfte das Gymnasium besuchen. Er sollte studieren. Nicht Kellner werden. Schon mit zehn Jahren besaß der Sohn ein Fahrrad. Und gehörte mit zwölf Jahren der patriotischen Jugendvereinigung an.
Roberts Leben erschöpfte sich im Dasein des Sohnes. Und der Satz: jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, war ihm zur Weltanschauung geworden. Robert flog, die Bestellungen auszuführen, verbeugte sich, dankte fürs Trinkgeld, verbeugte sich, dankte, sparte, scharrte zusammen, rechnete, strebte, wurde Zimmerkellner, dann Oberkellner, wies heimlichen Liebespärchen stille Zimmer an für ein paar Stunden, drückte Augen zu, sank in einen Abgrund der Liebe für seinen Sohn, schickte ihn auf die Universität, bekam graue Haare, war selig im Dienen, selig in seinem Sohne, besaß hundert Photographien von ihm, hatte die Kinderkleidchen aufgehoben, das Spielzeug: die Säbelchen, die Gewehrchen, die Bleisoldaten. Das Mützchen, auf dem stand »S. M. S. Hohenzollern«.
Der Sohn war zwanzig Jahre alt. Er bekam die Einberufung an einem Dienstag, bekam ein halbes Jahr später das eiserne Kreuz.
Und im Sommer 1916 bekam Robert die Nachricht, daß sein Sohn gefallen war. Auf dem Felde der Ehre.
Eine Welt war erschlagen.
Der Erschlagene las immer wieder: »Gefallen auf dem Felde der Ehre«. Den Zettel trug er bei sich in der Brieftasche, zwischen den Banknoten. Er las ihn, wenn ein Fremder kam und ein Zimmer verlangte, wenn er an der Billardecke stand und Bestellungen erwartete, wenn er, von der Glocke gerufen, durch den langen Gang lief, las ihn, bevor er das Zimmer betrat und nachdem er, die bezahlte Rechnung und das Trinkgeld in der Hand, das Zimmer wieder verlassen hatte. Er las ihn in der Küche, im Weinkeller, auf dem Klosett. »Gefallen auf dem Felde der Ehre«. Ehre. Das war ein Wort und bestand aus vier Buchstaben. Vier Buchstaben, die zusammen eine Lüge bildeten von solch höllischer Macht, daß ein ganzes Volk an diese vier Buchstaben angespannt und von sich selbst in ungeheuerlichstes Leid hineingezogen hatte werden können.
Das Feld der Ehre war nicht sichtbar, nicht vorstellbar, war Robert nicht begreifbar. Das war kein Feld, kein Acker, war keine Fläche, war nicht Nebel und nicht Luft. Es war das absolute Nichts. Und daran sollte er sich halten. Sein ganzes Leben lang. Hinter ihm lag nichts und vor ihm lag nichts. Robert stand in der Mitte auf dem Nichts.
Seine Hände servierten, quittierten, empfingen Trinkgelder. Wofür? Es gab keine Banknoten mehr. Und sein Sparkassenbuch war für ihn das Feld der Ehre. Und das Feld der Ehre war nicht begreifbar.
Robert gab die besten Zimmer auf Wunsch um die Hälfte des festgesetzten Preises ab, gab noch einen Salon dazu, ein Badezimmer. Wurde zum Servierkellner degradiert. Gab im Restaurant ohne Widerstreben die teueren Speisen und Weine billiger ab, wenn den Gästen die Rechnung zu hoch erschien. Wurde daraufhin nur noch zur Mithilfe herangezogen, wenn im großen Hotelsaal ein Fest, eine Versammlung war.
Gab es etwas Gleichgültigeres, als aus der Lebensstellung verdrängt worden zu sein? Das alles war nur das Feld der Ehre. War ein absolutes Nichts.
Oft fand er sich in seines Sohnes Zimmer, wohin er während des Krieges die Photographien, Kinderkleidchen, Säbelchen, Trommelchen, Gewehrchen, Bleisoldaten zusammengetragen hatte, und empfand nichts beim Betrachten dieser vergilbten und verkratzten Überbleibsel, ging, automatisch wie er eingetreten war, wieder hinaus.
Dieser Zustand, in dem Robert sich nur noch wie eine Maschine bewegte, dauerte wochenlang, bis eines Tages der Mensch in ihm die Kraft fand, sich dem Schmerze zu stellen. Seiner Hand entfiel die Photographie des Söhnchens – in Infanterieuniform, mit präsentiertem Gewehrchen –, und Robert sauste, von einem Dampfhammerschlag getroffen, hinunter in den Abgrund, das Herz bloßgelegt dem Schmerze und der Liebe. Robert schrie. Nur einmal. Und ganz kurz.
Von etwas Unnennbarem berührt, wich er der Erlösung, die im Schmerze liegt, aus.
Und als seine Frau ihn trösten wollte mit den Worten, die sie von dem unter dem gleichen Leide stehenden Kolonialwarenhändler, Bäcker, von der Nachbarin übernommen hatte: jetzt müsse man sich halt damit abfinden, schrak sie zurück vor Roberts gefährlich blickenden Augen und schwieg fernerhin.
Auch Robert schwieg, tat die Arbeit, die man ihm zuwies. Und da man ihn, der wiederholt Gäste fortlaufen ließ, ohne daß sie bezahlt hatten, nur noch als Wasserträger im Hotelcafé verwenden wollte, erklärte er sich auch hierzu bereit.
Robert wußte, daß etwas geschehen werde. Deshalb ertrug er weiter diese gefährliche Ruhe. Denn wie konnte es möglich sein, daß nichts geschah durch ihn, der nichts mehr verlieren konnte, da er alles schon verloren hatte? Der von einer dünnen Kellnerhaut überzogen war, unter welcher der Mensch schrie, entsetzlich lautlos der Schmerz, die Liebe schrieen? Durch den geringsten Anlaß konnte die Haut zerspringen. Dann stieg der Schrei.
Die Kindergewehrchen und Säbelchen hatte er, sich aus den Augen, hinüber ins Hotel getragen und hinter das Klavier gesteckt. Denn wenn er dieses Spielzeug nur anblickte, brannte ihn die Schuld. Aber wenn er einen mit dem Kriegsorden verzierten Leutnant bediente, zitterten seine Hände nicht.
Und als eines Tages ein patriotischer Jugendverein – halbwüchsige Jungen unter Gewehr – die Straße herauf und am Hotel vorbei das Lied trug: »Kann dir die Hand nicht geben, dieweil ich eben lad’ …«, fraß sich das Schuldbewußtsein glühend in Robert hinein. Denn auch er hatte seinen Sohn solche Lieder gelehrt und lehren lassen und voll Vaterstolz ihm zugehört.
In wilder Spannung stand er unterm Hotelportal und fühlte, daß sein Sprung auf die vorbeimarschierenden, schlecht beratenen Jünglinge ein Sprung in die Luft sein würde. Denn hinter den Jünglingen und hinter dem Kampfliede stand etwas, das nicht zu greifen war: ein unsichtbarer, unkörperlicher Gegner. Gott hielt ihn zurück von dem Sprunge. Gott hob ihn auf für die Minute, da der Feind greifbar werden würde, fühlte Robert.
Und eines Tages hatte er den Feind, der im Menschen selbst und nicht außer ihm ist, so scharf erkannt, daß seine Augen die eines schuldbewußten Mörders wurden. Da geschah es, daß Tränen wilden Zornes ihm hinter die Augen traten, wenn er ein Mädchen sah, das ihren Bräutigam, eine Frau, die ihren Mann, ein Elternpaar, das seinen Sohn verloren hatte und doch lächeln und wie immer das Glas Bier bestellen konnte.
Einer Mutter, der ihre Stütze fürs Alter, ihre Hoffnung, der Zentralpunkt all ihrer Liebe – ihr einziger Sohn zerstampft worden war auf dem Felde der Ehre und die zu Robert sagte, ›jetzt muß man sich halt damit abfinden‹, griff er wild an den Hals.
Gott strich über des Kellners Hände und legte dessen plötzlich von Liebe durchbebten Finger der Mutter sanft auf die Schulter. Denn nicht die Frau war schuld, nicht sie war der Feind und nicht ihre Worte, sondern das, was hinter den Worten stand. Und das war etwas, das nicht da war. Es war das Nichtvorhandensein der Liebe.
Das mörderische Schuldbewußtsein brannte die kleine Vaterliebe weg, so daß das Urgefühl der großen Liebe aufstehen konnte in ihm.
In tiefster Demut, in deren Mittelpunkt die unversiegbare Kraft der Liebe stand, verrichtete er die Arbeit des Pikkolos, trug den Gästen Wasser zu, spülte Gläser aus, ging, als die Glocke ihn rief, in den großen Hotelsaal.
Schlosser, Maurer, Schreiner, Spengler, Tapezierer, Glaser – zerarbeitete Männer, die haarigen, abschreckend häßlichen Tieren mit Menschenaugen glichen – füllten den großen Hotelsaal: die Bauarbeitervereinigung hielt ihre Jahresversammlung ab.
Robert brachte dem Redner, der auf dem Podium stand, eine Flasche voll Wasser und hörte, ans Klavier gelehnt, hinter dem die Säbelchen und Schießgewehrchen steckten, dem Redner zu.
Der erklärte, daß Unterstützungsgelder an arbeitslose und kranke Mitglieder dieses Jahr nicht ausbezahlt werden...
| Erscheint lt. Verlag | 2.11.2015 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Klassiker / Moderne Klassiker |
| Literatur ► Romane / Erzählungen | |
| Schlagworte | Der Mensch ist gut • Erzählungen • Kriegsgegner • Leonhard Frank • Novelle • Würzburg |
| ISBN-10 | 3-8412-1099-6 / 3841210996 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-1099-9 / 9783841210999 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,3 MB
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich