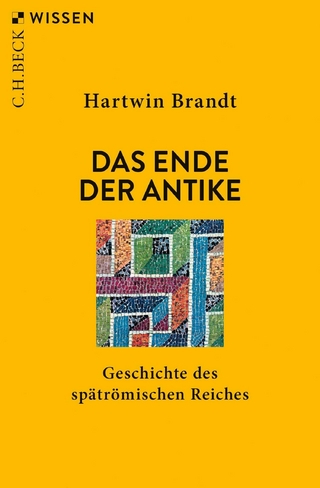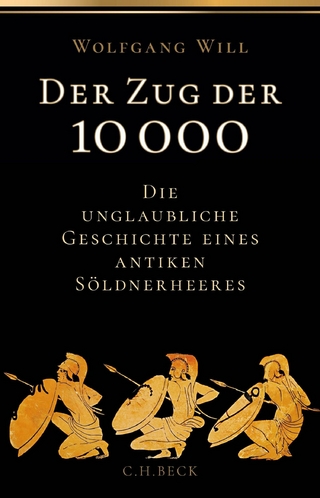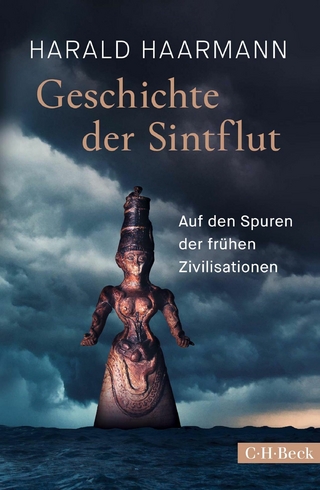Der Tod der Tribune (eBook)
308 Seiten
Verlag C.H.Beck
978-3-406-81373-3 (ISBN)
Charlotte Schubert ist Professorin em. für Alte Geschichte an der Universität Leipzig. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören neben der Geschichte der Medizin und der Wissenschaft im Allgemeinen die Digital Humanities und die Landverteilung in der Antike.
I
DAS ENDE
1. Tod auf dem Kapitol
Etwas noch nie Dagewesenes ereignete sich:[1] Ehrwürdige Senatoren stürmten durch Rom, aufgepeitscht durch die flammende Rede eines der ihren – Untergang der Respublica, drohende Tyrannenherrschaft, Aufruhr des Volkstribunen – so schallte es durch die Reihen. «Der Konsul verrät die Stadt» und «Der Tyrann muss gestürzt werden!» schrie Scipio Nasica und wie ein wilder Mob folgten ihm seine Standesgenossen. Zwar hatte der Konsul versucht zu beruhigen, hatte in der ihm eigenen Art eines hochgebildeten Juristen erklärt, dass Gewalt keine Lösung sei, dass er gar nicht daran denken würde, gegen einen römischen Bürger ohne Anklage und Prozess vorzugehen. Selbstverständlich jedoch würde er handeln, sollte der Tribun etwas gegen das Gesetz veranlassen: Ungesetzliche Beschlüsse würde er natürlich nicht anerkennen. Doch seine Worte verhallten ungehört in dem allgemeinen Geschrei. Die aufgeputschten Senatoren stießen alles beiseite, was sich ihnen in den Weg stellte. Bänke und Stühle wurden zerschlagen, Holzstücke wurden zu Knütteln und Prügeln, Anwesende, Gaffer, Passanten, Bürger zur Seite gestoßen. Erschrocken und in Panik floh die Menge, während die wutschnaubende Elite Roms auf das Kapitol stürmte.
Das Opfer erwartete sie bereits: Der Volkstribun Tiberius Sempronius Gracchus war schon am Morgen gewarnt worden, als er zu der von ihm einberufenen Volksversammlung auf dem Kapitol aufbrach. An dem Tag wollte er seine Wiederwahl sichern. Doch ein schlechtes Omen ließ bereits heraufziehendes Unheil erahnen: Die heiligen Hühner, deren Orakel vor jeder politischen Entscheidung zu befragen war, wollten nicht fressen. Sie waren partout nicht dazu zu bewegen, sich ihren Körnern zuzuwenden! Der antike Biograph Plutarch (um 45 bis um 125 n. Chr.) beschreibt die Szene:[2] Nur ein Hühnchen zeigte sich, wollte aber auch nicht fressen, vielmehr hob es den linken Flügel, streckte ein Bein aus – und lief zurück in den Käfig. Tiberius, als Augur ein professioneller Zeichendeuter, war ratlos. Er ahnte wohl das Verhängnis, erinnerte sich sogar an Schlangen, die einmal in seinem Helm gebrütet hatten, und stieß sich prompt den Zeh an seiner Türschwelle blutig. Auf dem Weg zum Kapitol fiel ihm dann auch noch ein Stein vor die Füße, der sich beim Kampf zweier Raben von einem Dach gelöst hatte. Für einen besonnenen, gottesfürchtigen Römer sollten das eigentlich genügend Omina gewesen sein, wieder umzukehren! Doch ein Tiberius Gracchus – Sohn des Konsuls und Zensors Tiberius Gracchus, Enkel des großen Scipio Africanus und Anführer der römischen Plebs – ließ sich doch nicht von einem Raben einschüchtern! Würde er sich andernfalls nicht lächerlich machen? Oder seinen Gegnern erst recht Munition liefern? Seine Freunde und Berater überzeugten ihn, die bösen Omina zu ignorieren, und so schritt er mutig einem freudigen Empfang der begeisterten Menge auf dem Kapitol entgegen. Doch scheint ihm der Anblick seiner jubelnden Anhänger zu Kopf gestiegen zu sein und damit nahm die verhängnisvolle Volksversammlung ihren Lauf. Geplant war, dass er sich zur Wiederwahl stellen würde – es wurde seine letzte Volksversammlung. Denn den Gegnern des Tiberius schien es, als habe er, begleitet von stürmischen Anhängern, das Kapitol besetzt – jenen Hügel, der das heilige Zentrum der Stadt Rom symbolisierte.
In der aufgeregten Menge war eine ordentliche Abstimmung unmöglich, so dass der Konsul Mucius die Versammlung abbrechen musste.[3] Gegner und Anhänger des Gracchus rempelten einander an und heizten die Stimmung weiter auf. Es war bekannt, dass die Gegner schon eine bewaffnete Bande in Stellung gebracht hatten, so dass Gracchus und seine Freunde um ihr Leben fürchteten. Was aber würde im Senat passieren? Würden sich die Gegner wirklich nicht scheuen gewalttätig zu werden?
Ein menschlicher Schutzwall bildete sich um Gracchus; die Stäbe der Liktoren, Zeichen der magistratischen Amtsgewalt, wurden zerbrochen, um gegen den befürchteten Angriff wenigstens etwas in der Hand zu haben. Tiberius geriet offenbar in Panik, gestikulierend zeigte er auf seinen Kopf und wollte so seinen Anhängern die ihm drohende Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Da tönte es von seinen Gegnern: «Jetzt hat er die Maske fallen gelassen, jetzt will er die Königskrone!» – Dass sich Tiberius Gracchus tatsächlich ein Königsdiadem aufs Haupt setzen wollte, ist indes wenig wahrscheinlich – war er doch ein urrömischer Aristokrat und Volkstribun. Zwar mag die Geste zweideutig geschienen haben. Doch die Lächerlichkeit dieses Vorwurfs scheint in der aufgeladenen, von Lärm, Geschrei und Wut angeheizten Situation niemandem – bis auf den gelassen bleibenden Konsul Mucius – bewusst geworden zu sein.
Und so nahm – wie es die Hühner angezeigt hatten – das Unheil seinen Lauf: Der senatorische Mob erschlug die Männer, die sich schützend um Tiberius Gracchus versammelt hatten. Der Volkstribun selbst versuchte zu fliehen, wurde festgehalten, verlor die Toga und floh in seiner Tunica, vorbei an all den Leichen, bis er selbst zu Boden stürzte. Nun führte den ersten Schlag – mit einem Stuhlbein, wie es bei Plutarch heißt – einer seiner Kollegen im Amt der Tribunen, ein Mann namens Publius Satureus, den zweiten ein gewisser Lucius Rufus. Man hat sich wohl eine Zeit lang solch zweifelhafter Heldentaten gerühmt, so dass uns die Namen derjenigen überliefert sind, die den sakrosankten – durch einen Schwurbund der Plebs als heilig und unverletzlich erklärten – Volkstribunen zu Tode geprügelt haben. Doch wenn nun ein Volkstribun den anderen erschlagen hätte, sollte das heißen, dass ein Unverletzlicher den anderen Unverletzlichen verletzen durfte? Der Historiker Diodor verstieg sich sogar zu der Behauptung, dass der Senator Nasica den Tiberius eigenhändig erschlagen habe![4] Mit Tiberius Gracchus starben 300 seiner Anhänger in diesem Blutbad, alle mit Knüppeln und Steinen erschlagen.[5]
Doch Wut und Hass waren mit Mord und Totschlag noch nicht Genüge getan: Als der jüngere Bruder Caius Gracchus um die Herausgabe des Leichnams des Volkstribunen bat, um ihn begraben zu dürfen, verweigerte man ihm dies. Stattdessen warf man den toten Volkstribunen und die anderen Erschlagenen in den Tiber.[6] Eine schlimmere Schändung des Toten und seiner Reputation ist kaum vorstellbar – war doch gerade das Begräbnis eines römischen Aristokraten für Familie und Klienten ein zentraler Bestandteil ihres symbolischen Kapitals. Bei diesen Gelegenheiten führten die großen Familien die historischen Verdienste ihres Geschlechts noch einmal dem ganzen versammelten römischen Volk vor Augen, indem sie die Totenmasken der bedeutendsten Vertreter ihres Hauses durch die Stadt trugen. Zwar mag Caius selbst wohl kaum solch ein öffentliches Begräbnis mit der Präsentation des Toten in einem Leichenzug, mit Reden und Zurschaustellung der Ahnenmasken im Sinn gehabt haben. Das hätte man ihm in der Situation schwerlich gestattet. Aber selbst die einfachen Bestattungsrituale wie Waschung, Salbung, Aufbahrung und Kremierung zu verweigern, bedeutete für seine Familie eine schier unerträgliche Schmach.
Es scheint, als habe damals für einen Moment in Rom der Ausnahmezustand geherrscht: Einen Volkstribunen und zahlreiche seiner Anhänger, gewiss ebenfalls römische Bürger, zu erschlagen war nicht nur ein unerhörtes Sakrileg. Dies war der größte denkbare Verstoß gegen das Recht eines jeden römischen Bürgers auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. Darauf hatte der Konsul Mucius im Senat hingewiesen. In höchstem Maß erstaunlich ist, dass dieser Frevel in der konkreten Situation selbst und auch noch danach so völlig ohne rechtliche Konsequenzen geblieben ist. Es gibt keine plausible Erklärung dafür – außer man geht eben davon aus, dass ein zwar nicht förmlich erklärter, wohl aber kollektiv wahrgenommener Ausnahmezustand eingetreten war.
Eigentlich gab es in Rom für Ausnahmezustände feste Regeln. In solch einer Situation konnte ein Diktator mit unbeschränkten Vollmachten für sechs Monate ernannt werden. Man erwartete, dass er nach Ablauf dieser Zeit sein Amt niederlegte – ein halbes Jahr galt den Römern als ausreichend, um Krisen aller Art im Inneren wie im Äußeren bewältigen zu können. Während dieser Zeit hatte ein Diktator – und nur ein Diktator – das Recht, einen römischen Bürger ohne Gerichtsverhandlung zum Tode zu verurteilen. Doch selbst der Inhaber solch eines Ausnahmeamtes hätte keinen Volkstribunen angreifen dürfen! Übrigens hat sich der griechisch-römische Historiker Appian (etwa 90 bis um...
| Erscheint lt. Verlag | 14.3.2024 |
|---|---|
| Zusatzinfo | mit 15 Abbildungen und 6 Karten |
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Vor- und Frühgeschichte / Antike | |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Altertum / Antike | |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Schlagworte | Altes Rom • Antike • Bürgerkriege • Caius Gracchus • Geschichte • Landreform • Mord • Politik • Römische Republik • Senat • Senatoren • Tiberius • Volkstribune |
| ISBN-10 | 3-406-81373-9 / 3406813739 |
| ISBN-13 | 978-3-406-81373-3 / 9783406813733 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich