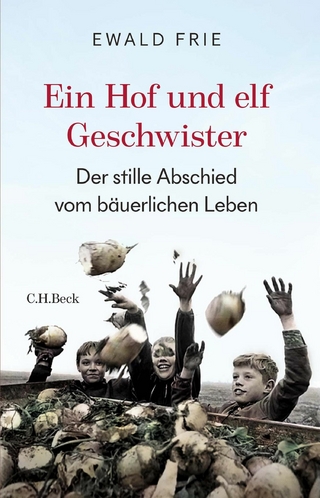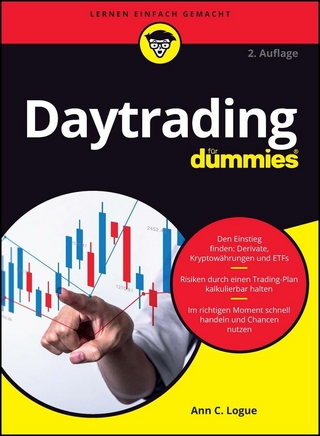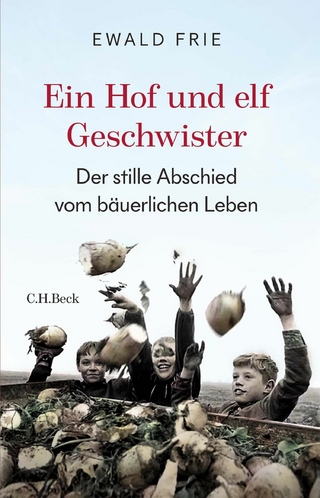Goethe und die Juden (eBook)
352 Seiten
Verlag C.H.Beck
978-3-406-81495-2 (ISBN)
W. Daniel Wilson lehrte als Professor für Germanistik von 1983 bis 2005 in Berkeley und von 2006 bis 2019 an der Universität London. Er hat vielbeachtete Bücher zu Goethe geschrieben, darunter sein aufsehenerregendes Buch über Goethe als Politiker: "Das Goethe-Tabu. Protest und Menschenrechte im klassischen Weimar".
1
Einleitung
Was sollen wir von einem Dichter denken, der das «göttliche Duldungs- und Schonungs-Gefühl» preist, das man bei der Lektüre von Lessings Nathan der Weise empfinde, aber einen wichtigen jüdischen Denker einen «Humanitätssalbader» nennt? Der mit einigen der bedeutendsten Juden seiner Zeit verkehrte, aber mit Wortverbindungen wie «Juden und Schelmen», «Juden und Huren» hantierte? Oder der aus Heilbronn schreibt, die Menschen seien «durchaus höflich und zeigen in ihrem Betragen eine gute natürliche stille bürgerliche Denkart», und dann im gleichen Atemzug mitteilt: «Es werden keine Juden hier gelitten»?
Ein heikles Thema
Goethe steht für viele Widersprüche; auch die Fachleute können nicht alle auflösen. Seine Haltungen zu zeitgenössischen Juden ändern sich ganz offensichtlich im Verlauf seines langen Lebens, vor allem unter dem Druck der erschütternden Revolutionsjahre mit ihren Folgen: Krieg und Nationalismus. Goethe hat sie aber auch – das wird auf den folgenden Seiten gezeigt – für die Öffentlichkeit anders als gegenüber Vertrauten ausgedrückt. Das Thema ist jedoch nicht nur ein biographisches oder literarisches (das zeitgenössische Judentum hat Goethe in verschwindend wenigen Werken behandelt). Denn Goethe ist nun einmal die wichtigste identitätsstiftende Figur der deutschen Kultur, so dass seine Haltung zu einer der brisantesten Fragen unserer – und seiner – Zeit ins Herz des deutschen Selbstverständnisses dringt.
Dass dieses Thema nie gründlich erforscht wurde, ist daher doppelt rätselhaft. Das letzte deutsche ‹Buch› über Goethe und die Juden, ein gedruckter Vortrag von 37 Seiten, erschien 1937. Sogar viele Goethe-Forscher halten das Thema für erschöpft, aber wenige haben genau hingeschaut – ein Phänomen mit einer eigenen Geschichte. Heute gibt es im Vergleich zu 1937 reiche Quellen und Hilfsmittel, doch kein Forscher hat sich mit den einschlägigen Archivquellen oder mit bestimmten Bereichen von Goethes amtlicher Tätigkeit befasst, etwa als Direktor des Weimarer Hoftheaters, wo jüdische Figuren auf der Bühne dargestellt wurden, oder als Mitverantwortlicher für diskriminierende Judengesetze.[1] Dabei geht es nicht allein um die Konsequenz oder Inkonsequenz von Goethes Aussagen und Handlungen, sondern auch um die große Frage, wie tief sich die Wurzeln der deutschen Judenfeindschaft im Boden der geistigen Kultur verzweigen. War Goethe wirklich die ‹große Ausnahme› in der langen Geschichte des ‹Antisemitismus› in Deutschland, wie man oft gemeint hat?
Um zu verstehen, warum dieses gewichtige, aber aufgeladene Thema seit den 1930er Jahren lediglich in einigen wenigen Aufsätzen in entlegenen Fachbüchern oder -zeitschriften behandelt wurde, muss ein Blick in die nicht allzu ferne Vergangenheit geworfen werden. Wie bei vielen deutschen Kontroversen führt die Spur zunächst zum Nationalsozialismus und dessen Auswirkungen zurück.
In der neueren Geschichtsschreibung wurde der Begriff ‹sekundärer Antisemitismus› oder ‹Schuldabwehrantisemitismus› für die Animosität erfunden, die auf eine angebliche Ausnutzung der Shoah durch Juden vor allem in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zielt.[2] Einen neuen Nährboden dafür gaben das Ende der deutschen Teilung und die Anfänge der Berliner Republik. Damals erntete die Rede des Schriftstellers Martin Walser bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Oktober 1998 stehenden Applaus und bedenklich viel Zustimmung in den folgenden Monaten; Walser selbst bezeichnete die Rede zwanzig Jahre später als «menschliches Versagen».[3] Doch obwohl das große Goethe-Jubeljahr 1999 vor der Tür stand, wurden Walsers Äußerungen zum Weimarer Klassiker kaum beachtet.
Die Walser-Kontroverse entfachte sich an seinen Äußerungen, er habe «lernen müssen wegzuschauen», nämlich von «den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationslagern», von Auschwitz. Er protestierte gegen die «Dauerpräsentation» oder «Instrumentalisierung unserer Schande», gegen den «Verdacht», der aufkomme, «wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk». Walser gestand, er habe beim Wegschauen «mehrere Zufluchtswinkel». Und der am ausführlichsten beschriebene Winkel, offenbar das Aushängeschild für die ‹Normalität› der deutschen Geistesgeschichte, war Goethe, und zwar in Walsers «Lieblingsjahrzehnt, 1790 bis 1800», als die anderen führenden Geister «Befürworter der Französischen Revolution» gewesen seien, Goethe jedoch ein Revolutionsgegner. Mitten im heißen politischen Streit sei Goethe souverän seiner Dichtung und seinen naturwissenschaftlichen Studien nachgegangen. Goethe, den Walser irrtümlich als politikabgewandt schilderte, und Schiller, den er irrtümlich zu den Revolutionsfreunden rechnete, hätten in einer zerrissenen Zeit gegenseitig «Toleranz» geübt.[4] Goethe und Schiller, so die Implikation, drückten in ihrer Politikverdrossenheit dem deutschen Volk das ersehnte Gütesiegel der ‹Normalität› auf.
Walser folgte einem seit 1945 bewährten Muster der sogenannten Vergangenheitsbewältigung. In der verzweifelten Zeit nach dem militärischen und moralischen ‹Zusammenbruch› wurde nach den Wurzeln der nationalsozialistischen Ideologie gesucht – oft in sehr unhistorischer Weise. Neben Nationalismus, Militarismus, Junkertum und Untertanenmentalität setzte man sich mit dem Judenhass in der deutschen Geschichte auseinander. Damals und seitdem wurden Geistesfiguren wie Martin Luther, Johann Gottlieb Fichte, Ernst Moritz Arndt, Achim von Arnim, Arthur Schopenhauer, Gustav Freytag, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche und andere mit Blick auf ihre antijüdischen (und teils nationalistischen) Haltungen unter die Lupe genommen. Doch aus dieser dunklen Flut politischer Verstrickung ragte immer die schimmernde Insel der Weimarer Klassik empor.
Dabei richtete sich die Sehnsucht nach ‹Normalität› mehr auf Goethe als auf Schiller, den die Nationalsozialisten zu einem der ihren zu machen suchten (das taten sie auch im Fall Goethes, aber später und weniger nachdrücklich).[5] Goethe galt fortan als politisches Alibi der Deutschen, zumal mit Blick auf das Ausland, wo er durch die ganze NS-Zeit hoch im Kurs gestanden hatte. Der ehemalige Nationalsozialist Erich Trunz, der in den späten 40er Jahren die jahrzehntelang populäre Hamburger Goethe-Ausgabe in die Wege leitete, bezeichnete Goethes Werk als «ein Kernstück des humanen Erbes der deutschen Kultur».[6] Später drückte er im Rückblick auf das Jahr 1949 die kulturpolitische Sendung seiner Edition deutlicher aus: «Es war das Jahr von Goethes 200. Geburtstag. Für viele Menschen war dies die Gelegenheit, auf Goethe und die große deutsche Tradition hinzuweisen, während rings in der Welt nur auf Deutschland geschimpft wurde und immer nur von Hitler geredet wurde.»[7]
Dass Goethes Alibifunktion bestimmte Bereiche seines politischen Lebens – vor allem die Verletzung von anerkannten Menschenrechten in Sachsen-Weimar[8] – nach 1945 zur Tabuzone machte, ist durchaus verständlich, förderte aber die Zuwendung zu unserem Thema nicht. Im Zeitraum bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1949 erschienen Hunderte von Goethe-Büchern – nach Hans Robert Mandelkow eine «fast süchtige Hinwendung zu Goethe als dem höchsten Repräsentanten eines besseren und humanen Deutschland im Moment seiner tiefsten Erniedrigung».[9] Doch wurde kein einziger wissenschaftlicher Aufsatz – geschweige ein Buch – zum brennend aktuellen Thema seiner Haltung zu Juden publiziert. In den Jahren 1945–1950 erschienen ganze drei Zeitungsartikel darüber, vorwiegend in jüdischen Zeitschriften und von Juden verfasst.[10] Es war generell eine Zeit des Schweigens zum Thema der Judenfeindschaft, aber zum Beispiel für Nietzsche und Luther herrschte ein solches Tabu seit etwa 1950 nicht mehr, für Goethe überdauerte es noch die 70er Jahre.[11] Auch vielen Juden galt Goethe als der Vertreter humaner Werte par excellence, seit der Gründerzeit das bevorzugte Vehikel der jüdischen Assimilation,[12] so dass jüdische Autoren (noch) nicht geneigt waren, Widersprüche an ihm zu erkennen – zumal der ‹Sekundärantisemitismus› lauerte. Der Mainstream und die Wissenschaft schwiegen ohnehin.
Doch wie in vielen Bereichen dieser Zeit wusste man mehr, als man zugab. Bis 1935/36 hatte das Nazi-Regime eine widersprüchliche Einstellung zu Goethe gezeigt: Hitler hatte schon in Mein Kampf auf Goethes wütende Ablehnung der...
| Erscheint lt. Verlag | 16.5.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Historische Romane | |
| Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Geld / Bank / Börse | |
| Reisen ► Reiseführer ► Europa | |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Judentum | |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Staat / Verwaltung | |
| ISBN-10 | 3-406-81495-6 / 3406814956 |
| ISBN-13 | 978-3-406-81495-2 / 9783406814952 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich