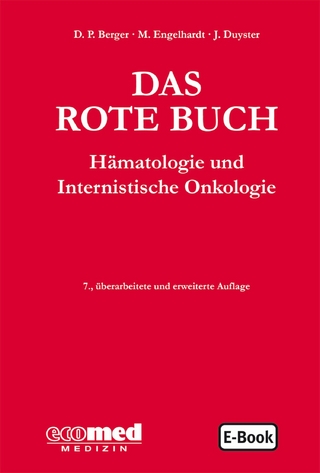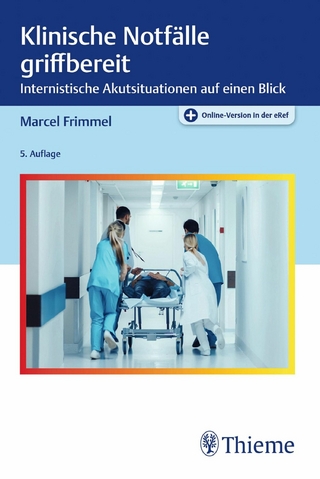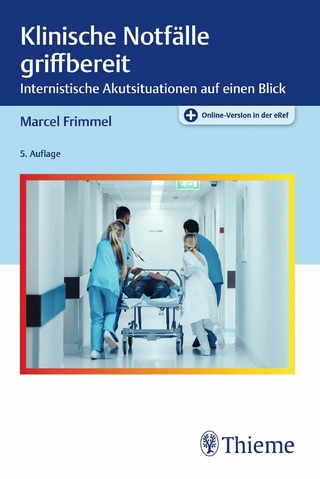Psychoedukation (eBook)
390 Seiten
Schattauer (Verlag)
978-3-608-26429-6 (ISBN)
Josef Bäuml, Prof. Dr. med., Leitender Oberarzt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar der TU München. Arbeitsschwerpunkte: Psychoedukation bei schizophrenen Psychosen, affektiven Erkrankungen und Borderline-Erkrankungen; Angehörigenarbeit und Trialog; Therapieresistente Psychosen und Depressionen.
Josef Bäuml Dr. med., Leitender Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München Gabi Pitschel-Walz Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München
Cover 1
Inhalt 21
I Konsensuspapier zu psychoedukativen Interventionen bei schizophrenen Erkrankungen 27
1 Definition 29
2 Ziele 30
2.1 Ziele für die Arbeit mit Patienten 30
2.2 Ziele für die Arbeit mit Angehörigen/ Bezugspersonen 30
2.3 Ziele für die Professionellen 30
3 Indikation/Voraussetzungen bzw. Kontraindikation 32
3.1 Teilnehmer an Patientengruppen 32
3.2 Teilnehmer an Angehörigengruppen 32
3.3 Teilnehmer an Familiengruppen 32
4 Organisatorischer Rahmen 33
5 Struktur und Inhalte 34
5.1 Allgemeines Hintergrundwissen 34
5.2 Praktisches Handlungswissen 34
5.3 Zentrale emotionale Themen 35
6 Didaktisches und psychotherapeutisches Vorgehen 37
6.1 Ablauf der Sitzungen 37
6.2 Psychotherapeutische Elemente 37
7 Qualifikation von Gruppenleitern 38
7.1 Vorbemerkungen 38
7.2 Persönliche Voraussetzungen der Gruppenleiter 38
7.3 Berufsgruppen 38
7.4 Beruflicher Erfahrungshintergrund 39
7.5 Psychotherapeutische Basisfertigkeiten 39
7.6 Praktische Ausbildung 39
7.7 Weiterbildungsangebote zur Psychoedukation 40
7.8 Ausblick 40
8 Implementierung 41
8.1 Einbindung des gesamten Teams 41
8.2 Stationäres Setting 42
8.3 Ambulantes Setting 42
9 Forschung und Qualitätssicherung 44
9.1 Stand der Forschung 44
9.2 Offene Forschungsfragen 46
9.3 Qualitätssicherung 47
10 Öffentlichkeitsarbeit 48
10.1 Bekanntmachung von konkreten psychoedukativen Angeboten 48
10.2 Informationen über Psychoedukation an sich 48
11 Selbsthilfebewegungen 50
12 Rechtliche Aspekte 52
12.1 Rechtsfragen als Inhalte der Psychoedukation 52
12.2 Rechtsfragen in Zusammenhang mit Organisation und Durchführung psychoedukativer Einzel- und Gruppentherapien 53
13 Abrechnungsmöglichkeiten 55
13.1 Stationärer Bereich 56
13.2 Ambulanter/komplementärer Bereich 56
14 Literatur und Medien für Laien 57
14.1 Ratgeber 57
14.2 Erfahrungsberichte von Betroffenen 57
14.3 Bücher zur Angehörigenarbeit 58
14.4 Videos und Filme 58
14.5 Software 59
14.6 Internet-Adressen 59
II Vertiefungskapitel zum Konsensuspapier über psychoedukative Interventionen bei schizophrenen Erkrankungen 61
15 Zur Geschichte der Psychoedukation 63
15.1 Einleitung 63
15.2 Professionalisierung der psychodidaktischen Wissensvermittlung 64
15.3 Historische Entwicklung der psychoedukativen Interventionen 64
15.4 Ausblick 67
16 Umfrage zur Häufigkeit und Durchführungvon Psychoedukation bei Schizophrenie an psychiatrischen Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz 68
16.1 Einleitung 68
16.2 Fragebogen-Design 68
16.3 Durchführung der Umfrage 69
16.4 Rücklauf 69
16.5 Ergebnisse der Umfrage 69
16.6 Schlussfolgerungen 72
17 Kooperative Pharmakotherapie und Mitbestimmungsaspekte im Rahmen psychoedukativer Interventionen 75
17.1 Einleitung 75
17.2 Zur Veränderung des Medikationsverhaltens schizophren Erkrankter nach einem Psychoedukativen Training 78
17.3 Das Psychoedukative Training für Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung 80
17.4 Untersuchungsgang 84
17.5 Zusammenfassung und Ausblick 89
18 Psychoedukation bei stationären Akutpatienten 92
18.1 Einleitung 92
18.2 Anforderungen an psychoedukative Interventionen in der Akutphase 92
18.3 Durchführung 93
18.4 Voraussetzungen für die Teilnahme 94
18.5 Effekte 95
18.6 Besonderheiten der Interventionen im Stundenverlauf 96
19 Psychoedukation bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko 98
19.1 Einleitung 98
19.2 Risikokriterien für erste psychotische Episoden 99
19.3 Effektivität von Frühintervention bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko 103
19.4 Besonderheiten bei der Behandlung von Personen mit erhöhtem Psychoserisiko 103
19.5 Psychoedukative Elemente der Einzeltherapie 107
19.6 Zusammenfassung 111
20 Psychoedukation bei ersterkrankten Patienten mit schizophrenen Störungen 112
20.1 Einleitung 112
20.2 Besonderheiten ersterkrankter Patienten 113
20.3 Anforderungen an psychoedukative Interventionen bei Ersterkrankten 115
20.4 Manual zur Psychoedukation bei Ersterkrankten 116
20.5 Einbeziehung der Angehörigen 117
20.6 Zusammenfassung und Ausblick 118
21 Motivierung zur Teilnahme an psychoedukativen Angehörigengruppen 119
21.1 Einleitung 119
21.2 Strategien zur Erhöhung der Inanspruchnahme von psychoedukativen Angehörigengruppen 125
21.3 Schlussfolgerungen 132
22 Diagnosemitteilung 133
22.1 Einleitung 133
22.2 Eigene Untersuchungen 134
22.3 Die praktische Durchführung der Diagnosemitteilung 136
22.4 Schlussfolgerungen 139
23 Psychoedukative Informationsvermittlung: „Pflicht und Kür“ 140
23.1 Einleitung 140
23.2 „Pflicht und Kür“ 141
23.3 Ausblick 154
24 Individualisierung und trialogische Dimension 156
24.1 Einleitung 156
24.2 Verschiedene Aspekte und Perspektiven der Individualisierung bei psychoedukativen Interventionen 156
24.3 Die trialogische Dimension 162
24.4 Ausblick 165
25 Psychoseseminare: Psychoedukative und rehabilitative Funktion 166
25.1 Einleitung 166
25.2 Psychoseseminare im deutschsprachigen Raum 167
25.3 Praktische Durchführung in Anlehnung an das Münchner Psychoseseminar 168
25.4 Das Münchner Psychoseseminar: Evaluation 172
25.5 Psychoseseminare: Chancen und Grenzen 176
25.6 Psychoedukative Elemente innerhalb des Psychoseseminars 178
25.7 Rehabilitative Funktion des Psychoseseminars 178
25.8 Zusammenfassung und Ausblick 179
26 Psychoedukative Mehrfamilieninterventionen bei schizophrenen Psychosen – am Beispiel des PEFI-Programms 181
26.1 Einführung 181
26.2 Teilnehmerkreis und Indikation für die Psychoedukative Mehrfamilienintervention 182
26.3 Überblick über das PEFI-Programm 183
26.4 Das Setting der Mehrfamilientherapie nach McFarlane 187
26.5 Ausblick 188
27 Diagnosenübergreifende psychoedukative Gruppen 189
27.1 Einleitung 189
27.2 Das Konzept der diagnosenübergreifenden psychoedukativen Gruppe 190
27.3 Schlussfolgerungen und Bewertung 201
28 Psychoedukation bei Patienten mit der Doppeldiagnose schizophrene Psychose und Sucht 202
28.1 Einleitung 202
28.2 Grundlagen der integrativen Therapie 203
28.3 Umsetzung des integrativen Behandlungskonzepts auf der Doppeldiagnosestation 206
28.4 Das Behandlungskonzept GOAL – Gesund und Ohne Abhängigkeit Leben 208
28.5 Ausblick 214
29 Bilder, Metaphern und Materialien bei der Vermittlung zentraler psychoedukativer Themen 215
29.1 Einleitung 215
29.2 Bilder und Metaphern 215
29.3 Schlussbemerkung 227
30 Einsatz neuer Medien zur Unterstützungder Psychoedukation – Trainings- und Informationsprogramm für Psychosebetroffene (TIP) 228
30.1 Einleitung 228
30.2 Haben neue Medien in der Psychoedukation überhaupt eine Berechtigung? 228
30.3 TIP – Entwicklung der Software 229
30.4 TIP – die Struktur 230
30.5 TIP – die Inhalte 231
30.6 TIP – Beispielansichten 235
30.7 TIP – die Technik 239
30.8 TIP – die Perspektiven 239
31 Psychotherapeutische Dimensionen von Psychoedukation 240
31.1 Einleitung 240
31.2 Psychoedukation in Abgrenzung zur Psychotherapie 240
31.3 Psychoedukation als Dimension von Psychotherapie 242
31.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 245
32 Coping-Forschung und bewältigungsorientierte Therapien bei schizophrenen Störungen 246
32.1 Einleitung 246
32.2 Bewältigungsformen bei schizophrenen Störungen 246
32.3 Bewältigungsorientierte Therapie: Erkennen und angemessener Umgang mit Krankheitssymptomen 248
32.4 Bewältigungsorientierte Therapie: Erkennen und angemessener Umgang mit multiplen Belastungen 252
32.5 Zusammenfassung 259
33 Gesprächspsychotherapeutische Aspekte der Psychoedukation 261
33.1 Einleitung 261
33.2 Gesprächspsychotherapie und Psychoedukation 261
33.3 Schlussfolgerungen 268
34 Psychoedukative Modelle außerhalb von Klinik und Institutsambulanz – Erfahrungen aus einem Modellprojekt 270
34.1 Einleitung 270
34.2 Ambulante Psychoedukation in der Literatur 270
34.3 Modellübersicht 271
34.4 Herausforderungen 273
34.5 Wege zum Erfolg 274
34.6 Schlussfolgerungen und Ausblick 276
35 Psychoedukation im gemeindepsychiatrischen Verbund 278
35.1 Einleitung 278
35.2 Das PEGASUS-Programm 278
35.3 Implementierung des PEGASUS-Programms in Bielefeld und Paderborn 281
35.4 Unterstützung der Implementierung des PEGASUS-Konzeptes in anderen Regionen 285
35.5 Schlussfolgerungen 287
36 Psychoedukation im Rahmen der Integrierten Versorgung 289
36.1 Einleitung 289
36.2 Warum ist die Integrierte Versorgung für Psychoedukatoren interessant? 289
36.3 Was ist Integrierte Versorgung? 290
36.4 Wer sollte einen IV-Antrag stellen? 290
36.5 Das „Münchner Modell“ 293
36.6 Zusammenfassung 295
37 Evaluation psychoedukativer Interventionen 296
37.1 Einleitung 296
37.2 Basisevaluation 296
37.3 Erweiterte Evaluation 300
37.4 Ausblick 310
38 Forschungsüberblick und Forschungsfragen zur Evidenzbasierung 311
38.1 Interventionsstudien 311
38.2 Meta-Analysen 315
38.3 Kritische Forschungsfragen und Empfehlungen für künftige Studien 317
38.4 Zusammenfassung und Ausblick 318
39 Kampf dem Stigma – Anti-Stigma-Kampagne und lokale Initiativen 320
39.1 Einleitung 320
39.2 Anti-Stigma-Kampagne der World Psychiatric Association (WPA) 320
39.3 Anti-Stigma-Kampagne „von unten“ 322
39.4 Ausblick 322
40 Selbsthilfebewegung von Patienten und Angehörigen 324
40.1 Einleitung 324
40.2 Historische Entwicklung der Selbsthilfebewegung von Psychiatrie-Erfahrenen (Patienten) und Angehörigen 324
40.3 Aktueller Stand – ein Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Interessen der Selbsthilfegruppen und der Professionellen 331
40.4 Ausblick 332
41 „Peer to Peer“-Psychoedukation 334
41.1 Einleitung 334
41.2 Eigene Untersuchungen 334
41.3 Schlussfolgerungen 339
42 Rechtsfragen 341
42.1 Einleitung 341
42.2 Der rechtliche Rahmen der Behandlung 341
42.3 Schizophrenie, Psychopharmaka und Fahrtauglichkeit 349
42.4 Andere Rechtsfragen 351
42.5 Schlussfolgerungen 353
Literaturverzeichnis 355
Sachverzeichnis 381
| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2018 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete |
| Schlagworte | Affektive Störung • Psychoedukation • psychoedukative Intervention • Schizophrenie • trialogische Psychatrie |
| ISBN-10 | 3-608-26429-9 / 3608264299 |
| ISBN-13 | 978-3-608-26429-6 / 9783608264296 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich