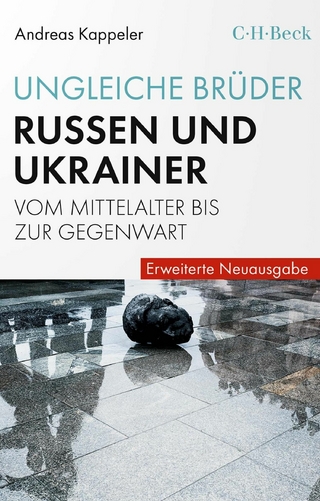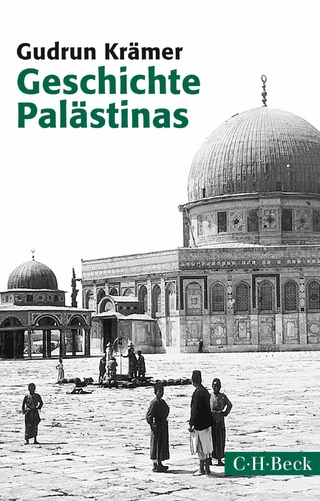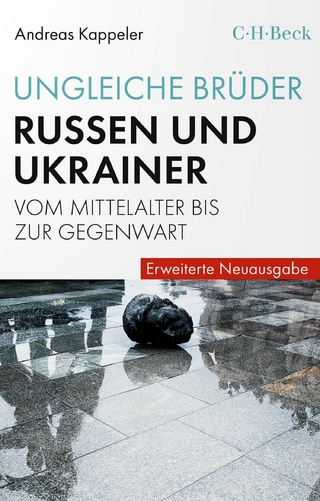Kleine Geschichte Oberfrankens (eBook)
176 Seiten
Verlag Friedrich Pustet
978-3-7917-6179-4 (ISBN)
Günter Dippold, Dr. phil., geb. 1961, ist Historiker, seit 1994 Bezirksheimatpfleger von Oberfranken und seit 2004 Honorarprofessor für Europäische Ethnologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Zahlreiche Publikationen zur fränkischen Geschichte.
Günter Dippold, Dr. phil., geb. 1961, ist Historiker, seit 1994 Bezirksheimatpfleger von Oberfranken und seit 2004 Honorarprofessor für Europäische Ethnologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Zahlreiche Publikationen zur fränkischen Geschichte.
Von den ersten Siedlern bis ins Hochmittelalter
Erste menschliche Spuren im heutigen Oberfranken stammen aus dem Mittelpaläolithikum. An verschiedenen Orten, beispielsweise oberhalb von Kösten im oberen Maintal und wenige Kilometer entfernt auf dem Schneyer Berg, wurden, teilweise schon an der Wende vom 19. zum 20. Jh., rund 70.000 bis 80.000 Jahre alte Faustkeile und Schaber gefunden, aber auch Artefakte aus dem Mesolithikum.
Als im Neolithikum Menschen sich dauerhaft niederließen und begannen, Ackerbau zu treiben, wählten sie Siedlungsorte mit leichten Böden, die mit hölzernen Werkzeugen zu bearbeiten waren. Manche dieser ersten „Dörfer“ lagen in der Nähe prägnanter Dolomitfelsen, die als Kultplätze dienten. Nur vereinzelt lassen sich Befestigungen durch umgebende Gräben nachweisen.
Unter den Siedlungen der Urnenfelderzeit, aus der zahlreiche Gräber erhalten sind, ragt die Heunischenburg bei Kronach heraus. Die dritte Anlage an diesem Platz, im 9. Jh. v. Chr. entstanden, gilt als älteste bekannte Steinbefestigung nördlich der Alpen. Da die Funde lediglich auf die Anwesenheit von Männern hinweisen, wird die Heunischenburg als Garnison gedeutet, die die Kupfer- und Zinntransporte aus Böhmen und dem Fichtelgebirge nach Westen sichern sollte.
Ebenfalls in der späten Bronzezeit entstanden größere, von einer Pfostenschlitzmauer umfangene Höhensiedlungen. Die bedeutendste unter ihnen dürfte in der Region die Ehrenbürg gewesen sein, ein Inselberg nahe Forchheim, nahe dem Zusammenfluss von Regnitz und Wiesent. Dieser Berg war seit dem 14. Jh. v. Chr. besiedelt und befestigt. Seine größte Bedeutung erlangte er in frühkeltischer Zeit, zwischen ungefähr 520 und 380 v. Chr. Rund 10.000 Kellergruben, die sich auf dem 36 Hektar großen Hochplateau nachweisen lassen, zeugen von einer dichten, stadtartigen Besiedlung. Aus derselben Epoche sind auch kleinere, befestigte Höhensiedlungen im Bereich der nördlichen Frankenalb nachgewiesen (Kasendorf, Staffelberg, Burggaillenreuth u. a.).
Die Ehrenbürg bei Forchheim, 2012
In spätkeltischer Zeit (2./1. Jh. v. Chr.) erscheint als dominante Siedlung das Oppidum auf dem Staffelberg, das seit langem mit dem von Ptolemäus erwähnten Menosgada identifiziert wird. Es gliederte sich in eine Oberstadt auf dem Hochplateau als Wohnsitz der Elite und eine Unterstadt und war insgesamt 49 ha groß. Zur Albhochfläche war es durch eine mächtige Pfostenschlitzmauer gesichert. Ein imposantes Stadttor auf halber Höhe zum Maintal wurde 2018/19 ergraben. Münzfunde deuten auf wirtschaftliche Beziehungen zu Böhmen, der Nordschweiz, Manching und Rom hin; zwei eiserne Münzstempel zeigen an, dass auf dem Staffelberg Geld geprägt wurde. Dieses Oppidum wurde einige Jahrzehnte vor Christi Geburt aufgegeben.
Dass ankommende Germanen die Kelten verdrängten, lässt sich in Altendorf im Regnitztal südlich von Bamberg beobachten, wo neben einer spätkeltischen eine germanische Siedlung entstand. Gröbere Keramik germanischer Provenienz wird neben Resten feinerer, keltischer Gefäße gefunden.
Keltische Gefäße aus einer Kellergrube auf dem Staffelberg, ergraben in den 1980er Jahren
Die vorgeschichtlichen Bodendenkmäler konzentrieren sich auf den Westen des Regierungsbezirks, auf das Main- und Regnitzgebiet sowie die Frankenalb. Der Frankenwald, das Fichtelgebirge und das Hofer Land sind vergleichsweise fundarm und waren offenbar eher dünn besiedelt, in manchen Landstrichen womöglich bis ins hohe Mittelalter hinein.
Ab dem späten 4. Jh. n. Chr. drangen verschiedene germanische Völker ins heutige Oberfranken vor. Unter den wenigen Befestigungen der Spätantike zeichnet sich die Wehranlage auf dem Reisberg bei Scheßlitz am Westrand der Frankenalb aus. In ihrem Areal wurden ansehnlicher Schmuck und Geräte gefunden. Nach einigen Jahrzehnten wurde die Anlage gewaltsam zerstört.
Im Frankenreich
Seit dem 6. Jh. wurde der Westen des heutigen Oberfranken dem Frankenreich einverleibt. Die merowingischen Könige errichteten Königshöfe in Forchheim und Hallstadt. Sie lagen noch im frühen 9. Jh. an der Ostgrenze des Frankenreichs.
Als 741 der fränkische Hausmeier Karlmann das entstehende Bistum Würzburg mit Besitz ausstattete, übereignete er ihm den Zehnten von 26 königlichen Gütern, darunter der Königshof Halazestat (Hallstadt). Archäologische Befunde deuten darauf hin, dass ein Friedhof in Hallstadt spätestens seit dem frühen 6. Jh. bestand. Der Ort lag an einer Fernstraße von Erfurt nach Regensburg, und auch Ost-West-Verbindungen werden ihn wohl berührt haben. So gewann der Königshof über seine administrative Funktion hinaus gewiss Bedeutung als Handelsplatz.
Forchheim, ab 805 genannt, war bereits um die Mitte des 9. Jhs. Stätte von Hoftagen. 900 und 911 fand die Wahl des römischen Königs in der Pfalz an der Regnitz statt.
Zur Zeit Kaiser Karls des Großen (reg. 768–814) sind neben dem Königtum auch Große des Reichs bis aus dem Neckarraum nachgewiesen, die an der äußersten Ostgrenze des fränkischen Reichs begütert waren. Belegt ist dies durch mehrere Schenkungen an das Kloster Fulda im späten 8. und im 9. Jh. Unter jenen Familien errangen die wohl in der Wetterau beheimateten Popponen – in der modernen Geschichtsforschung so benannt nach einem Ahnherrn des Geschlechts – die stärkste Position im östlichen Franken. Sie errichteten wohl die Burg auf dem späteren Domberg von Bamberg oder verstärkten zumindest die Befestigung, wie Bodenfunde des 9. Jhs. nahelegen. Wegen dieses wichtigen Sitzes hat sich für die Familie die Bezeichnung „Babenberger“ eingebürgert.
Wohl im 8. Jh. war das heutige Franken in Grafschaften gegliedert worden, in denen jeweils ein Graf als Vertreter der königlichen Gewalt amtierte. Dabei erlangte der Babenberger Heinrich († 886) die Grafenwürde sowohl im Grabfeldgau mit dem Mittelpunkt Münnerstadt als auch im Volkfeldgau, der sich von der Regnitz bis zum Maindreieck erstreckte, und im Radenzgau, der sich weitgehend mit dem jetzigen Oberfranken deckte.
Im späten 9. Jh. gerieten die Babenberger in immer schärfere Konkurrenz mit den Konradinern, die ihr Machtzentrum im heutigen Hessen hatten und von dem mit ihnen verschwägerten Kaiser Arnulf († 899) begünstigt wurden. Nach seinem Tod wurde der Streit zwischen den beiden Familien ab 902 mit Waffengewalt ausgetragen, wobei die Babenberger 906 endgültig unterlagen. Der Babenberger Adalbert wurde hingerichtet, Bamberg fiel in königliche Hand. 973 schenkte es Kaiser Otto II. (reg. 973–983) seinem bayerischen Vetter, Herzog Heinrich dem Zänker (reg. 955–976 und 985–995).
Die Markgrafen von Schweinfurt
Trotz der Niederlage der Babenberger behaupteten ihre mutmaßlichen Nachkommen, die Grafen von Schweinfurt, eine starke Position im östlichen Franken. Kurz vor der Mitte des 10. Jhs. können wir die Familie mit Graf Berthold († 980) erstmals fassen. Dieses einflussreiche Geschlecht wird in der Mittelalterforschung nach einer ihrer Hauptburgen, nämlich Schweinfurt, benannt, doch residierten die Grafen ebenso in Sulzbach, Oberammerthal, Hersbruck, Creußen, Kronach, Burgkunstadt und Banz.
Sie vereinten in ihrer Hand drei Grafschaften: den Volkfeldgau, den Radenzgau und den südöstlich anschließenden Nordgau. Das Geschlecht dominierte damit ein Gebiet, das vom Mainknie bei Schweinfurt bis an den Regen und den Böhmerwald reichte und den größten Teil des heutigen Oberfranken einschloss. „Markgraf“ (marchio) nannten sich die Schweinfurter, um ihre besondere Würde als dreifache Grafen zu betonen.
Einen Einbruch erlebte ihre Macht durch den Aufstand des Grafen Heinrich (Hezilo) gegen König Heinrich II. († 1024). Hezilo hatte dem bayerischen Herzog Heinrich 1002 geholfen, die Königswürde zu erlangen. Doch danach fühlte Markgraf Hezilo sich um den politischen Lohn, nämlich die bayerische Herzogswürde, betrogen. Er erhob sich gemeinsam mit dem polnischen König Bolesław Chrobry († 1025) gegen den König. Hezilo wurde 1003 geschlagen und verlor seine Grafschaften und königlichen Lehen. Immerhin behielt er seine umfangreichen Eigengüter, die er möglicherweise in der Folge stärker durchdrang. Der Ortsname „Heinersreuth“, der im Raum Kulmbach/Bayreuth siebenmal vorkommt, mag in mehreren Fällen auf Rodungen unter Graf Heinrich/Hezilo zurückgehen. Weiterhin besaßen die Schweinfurter die Vorherrschaft rund um den Obermainbogen und in der nördlichen Frankenalb.
Andererseits war, weil der Schweinfurter seine Grafschaften verloren hatte, ein Machtvakuum entstanden, das Hezilo nach einer gewissen Frist erneut zu füllen drohte. Um dies zu vereiteln, gründete...
| Erscheint lt. Verlag | 15.9.2020 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Bayerische Geschichte |
| Verlagsort | Regensburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |
| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |
| Schlagworte | Bayern • Franken • Geschichte • Oberfranken • Weltkulturerbe |
| ISBN-10 | 3-7917-6179-X / 379176179X |
| ISBN-13 | 978-3-7917-6179-4 / 9783791761794 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 9,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich