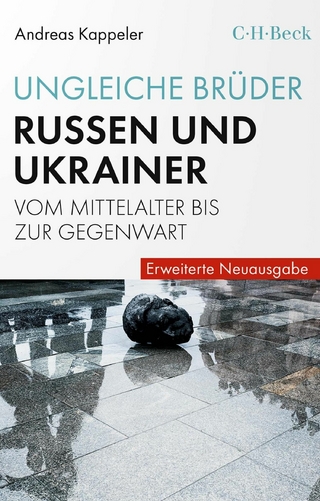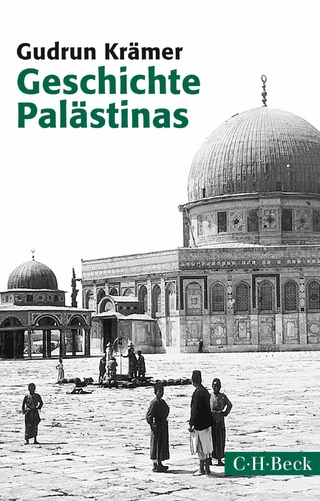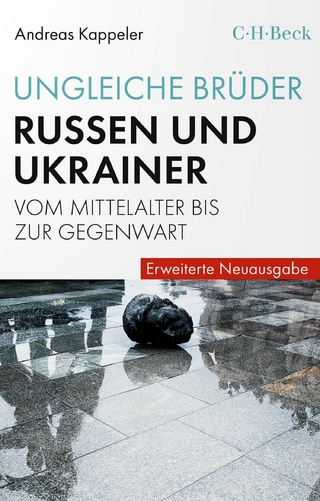Die Elbe (eBook)
304 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01897-6 (ISBN)
Burkhard Müller, geboren 1959, studierte Deutsch und Latein in Würzburg, wo er mit einer Arbeit über Karl Kraus promovierte. Er lehrt Latein an der Technischen Universität Chemnitz, ist Autor und Kritiker der «Süddeutschen Zeitung». 2008 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet, 2012 mit der Übersetzerbarke des Verbands deutschsprachiger Übersetzer. Zuletzt erschienen «Deutsche Grenzen. Reisen durch die Mitte Europas» (mit Thomas Steinfeld, 2018) und «Apoll und Daphne. Geschichte einer Verwandlung» (2020).
Burkhard Müller, geboren 1959 in Schweinfurt, studierte Deutsch und Latein in Würzburg, wo er mit einer Arbeit über Karl Kraus promovierte. Er lehrt Latein an der Technischen Universität Chemnitz und ist Autor und Kritiker der «Süddeutschen Zeitung». 2008 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet, 2012 mit der Übersetzerbarke des Verbands deutschsprachiger Übersetzer. Burkhard Müller lebt in Chemnitz.
Erster Teil Die böhmische Elbe
Wo ist die Quelle?
Schneekoppe! Wer ungefähr so alt ist wie ich, das heißt plus minus sechzig, dem klingt dieses Wort, mit seiner lang gedehnten ersten Silbe und den zwei kürzeren verhallenden hinterher, noch immer wie ein Ruf der Sehnsucht in den Ohren. Kaum erinnere ich mich an die Produkte, die so im Fernsehen beworben wurden; es handelte sich wohl um Reformhauswaren. Bei uns kam so was nicht auf den Tisch. Spät erst sah ich den namengebenden Berg, aber gehört habe ich ihn schon viel früher.
Als ich historische Phasen zu unterscheiden lernte, meinte ich, dass das Warenzeichen «Schneekoppe» ein Erkennungssignal wäre, das Vertriebene aus Schlesien und dem Sudetenland untereinander verwendeten. Aber das stimmt nicht. Die Firma «Schneekoppe» existiert schon seit fast zweihundert Jahren, als es noch gar keine Marken im modernen Sinn gab. Damals wurden vor allem Leinölprodukte angeboten. Die Firma zog nach Westen um wie Zeiss oder Reclam. Es gibt sie übrigens immer noch (sie gehört inzwischen dem ehemaligen Fußballer Philipp Lahm), doch habe ich schon lange keine Reklame mehr für sie zu Gesicht bekommen.
Die Schneekoppe gab es für uns als Kinder aber nicht nur in der Werbung. Wir hatten ein Buch von Rübezahl, aus dem wir immer mal wieder vorgelesen bekamen. So wurden uns Riesengebirge und Schneekoppe zu einer märchenhaften Referenz: irgendwo weit weg, aber mit festem Namen behaftet. Ein gewaltiger Naturgeist war Rübezahl, von wandelbarer Gestalt, gütig zu guten und armen Menschen, die im schlesischen Gebirge ihr kärgliches Auskommen mit Weberei und Holzeinschlag fanden, aber auch der Tücke und Rachsucht fähig.
Und dann gab es natürlich auch noch den Rübezahl des Liedes. Mein Vater sang bei jeder Gelegenheit, beim Kochen, Spülen oder Autofahren, und eines dieser Lieder war: «Hohe Tannen weisen die Sterne / An der Iser wildspringender Flut. / Liegt das Lager auch in weiter Ferne / Doch du, Rübezahl, hütest es gut.» Die hohen Tannen, die wildspringende Flut, die hatten was, auch wenn ich nicht wusste, wo die Iser sprang. Ich kann alles immer noch auswendig, ohne mich je darum bemüht zu haben, einfach weil das Kinderohr eine Zisterne ist, aus der auch später nicht ein Tropfen verloren geht: «Komm zu uns an das flackernde Feuer / in den Bergen, bei stürmischer Nacht. / Schirm die Zelte, die Heimat, die teure. / Bleib bei uns, halte treuliche Wacht.» Das Schirmen, die teure Heimat: Das alles erkannte ich damals nicht in seinem jungen und mutmaßlich völkischen Charakter, der sich Mühe gab, wie uralt zu klingen. In mir zurück blieben stattdessen hohe Tannen und Rübezahl.
Wir sind, indem wir der Elbe nachgehen, nicht auf der schlesischen, sondern auf der böhmischen Seite des Grenzgebirges unterwegs. Rübezahl existiert auch auf Tschechisch, vor allem an Wirtshäusern und Volkskunstläden taucht er auf. Krakonoš heißt er hier und sieht aus, wie er klingt: grimmig, grob und mit einem Baumstamm bewaffnet. Er soll uns zur Elbquelle führen.
Wer den Ruf «Schneekoppe!» in der Reklamewelt der Kindheit gehört hat, den grüßt sie anders, als wenn sie ihm ganz fremd wäre. Sie grüßt wirklich: als einziger und höchster Berg, der sich im März, wo sich überall sonst schon der Frühling hervorwagt, in vollkommen baumfreies Weiß hüllt. Man sieht ihn schon aus weitem Abstand, wie er das sanft gewellte Hügelland überragt.
Die Schneekoppe, tschechisch Sněžka, ist der höchste Berg Mitteleuropas. Zwischen den Alpen und den nördlichen Meeren, einem Areal von rund einer Million Quadratkilometern (von denen Deutschland etwa ein Drittel einnimmt), gibt es keinen Berg, der die 1600 Meter erreichen würde oder überträfe, die die Schneekoppe misst. Wir starten im zögerlichen Frühling und kommen im Winter an.
Zur Quelle der Elbe wollen wir; und da diese sich unfern des Gipfels befindet, der Gipfel uns aber schon aus großer Ferne entgegenleuchtet, meinen wir, auf Sicht fahren zu können. Das erweist sich als Irrtum. Alles ist ausschließlich auf Tschechisch beschriftet. Die Hinweisschilder sehen anders aus als die deutschen, mit einem kleinen weißen Zieldreieck, der dem blauen Schild oben aufsitzt wie die Schneekoppe dem Horizont, und alle wirken, als wollten sie uns direkt zum Berg hinführen – doch wir verfranzen uns immer mehr. Wir haben es mit einem intensiv genutzten Wintersportgebiet zu tun, welches aber ausschließlich von den Bürgern jener kleinen Nation aufgesucht wird, auf deren Territorium es sich befindet. Das ist in den Alpen anders, wohin die Deutschen, Holländer, Briten zum Skifahren strömen, weil sie selbst keine wirklich hohen Berge haben. Vielleicht gibt es auch Tschechen in den Alpen, aber jedenfalls keine Nicht-Tschechen im Riesengebirge, denn so weit für ein letztlich subalpines Vergnügen zu reisen, fällt den Auswärtigen nicht ein. Der Schnee in den Höhenlagen ist jetzt im März zwar noch da, aber ziemlich matschig.
Wir folgen dem Schild «Pec pod Sněžkou», weil wir darin die tschechische Schneekoppe erkennen. Es handelt sich, wie wir später herausfinden, um den vormals deutschen Ort Petzer unter der Schneekoppe, der aber von unserem Ziel ein Stück abliegt. Lang fahren wir das enge Tal eines wilden Flusses voller Felsen hinauf, das an den Hängen überall mit Skihotels und Ähnlichem bebaut ist, und sind uns schon sicher, das wäre die junge Elbe. Es ist aber bloß die Úpa, die in die Elbe mündet; wir kehren um. Endlich finden wir die Elbe doch, sie durchquert den Ferienort Špindlerův Mlýn, früher auf Deutsch Spindlermühle, und sieht genauso aus wie die Úpa, das heißt vor allem: nicht größer. Wer hat wann entschieden, dass von zwei sich vereinigenden Wasserläufen der eine der Hauptstrom und der andere bloß der Nebenfluss sein soll? Festgelegt werden musste es offensichtlich, aber es geschah, wie es scheint, in einem Akt der Willkür. Das Problem wird uns weiter stromabwärts noch einmal beschäftigen, wo Elbe und Moldau zusammenfinden und es heißt, die Moldau münde in die Elbe, obwohl die Moldau der deutlich längere und größere Fluss ist. Ähnlich steht es ja auch mit Mississippi und Missouri sowie mit Donau und Inn in Passau. Dort lehrt der Augenschein, dass der mächtige Inn es ist, der die kleinere Donau in sich aufnimmt; aber so steht es eben nicht in den Karten.
Je mehr man sich ihm naht, desto fraglicher wird der Ursprung. Aus allen Schluchten und Spalten sprudeln die Wasser hervor, jedes davon könnte der entscheidende namengebende Quell sein. Schließlich stehen wir auf dem Kamm; ein weißer Adler auf rotem Grund verkündet, dass hier die polnische Grenze verläuft. Höher hinauf geht es nicht mehr. Es herrscht reger Fußgängerbetrieb. Ringsum stehen, weit auseinander, weil es hier mehr Platz gibt als im beengten Tal, große düstere Hotelkästen, Bauden genannt. Viele von ihnen sind mit dunklem Holz verkleidet und mit kleinen, hölzernen Balkonen geschmückt, sie stammen offenbar noch aus der Zeit der sozialistischen Moderne. Neuere Gebäude finden sich kaum, obwohl die Touristen mit ihren Geländewagen und glänzenden Skianzügen sich ganz auf der Höhe der Gegenwart bewegen.
Wir haben kein Navi, unsere Karten sind schlecht, die tschechischen Hinweise an den Straßen für uns nicht verständlich. Unser Schuhwerk eignet sich nicht für den tiefen, nassen Schnee. Wo soll hier die Quelle sein? Vermutlich nicht weit; aber doch außerhalb unserer Reichweite. Es kommt nicht zum Trophäen-Selfie. Klar ist: Wir befinden uns im Quellfeld, doch wir erreichen nicht jenes kleine Betonbecken, dessen Bilder wir gesehen haben, viel unscheinbarer als die bombastische Donauquelle in Donaueschingen, die offiziell als jener Punkt gilt, von dem der Strom, als kleiner Wasserfaden erst, seinen Ausgang nimmt. Wo wir der Elbe unzweifelhaft ansichtig werden, etliche Kilometer quellabwärts, hat sie schon eine Breite von mehreren Metern; und obwohl recht flach, verfügt sie doch sichtbar über die Macht, Steine zu rollen und Bäume zu stürzen. Auch die hohen Mauern, zwischen die man sie in den Ortschaften gezwängt hat, verraten den Respekt vor der Kraft des Stroms.
Das Problem des genauen Verlaufs wird sich am Ende wiederholen: Wo geht die Elbe in die Nordsee über? Immer weiter öffnet sich dann der Trichter, immer salziger wird das Wasser, Ebbe und Flut spielen herein. Gern wüsste ich, wer ihre Länge mit genau 1094 Kilometern angegeben hat. Auch beim Rhein glaubte man bis vor ein paar Jahren, die Länge genau zu kennen – und stellte eines Tages betroffen fest, dass er hundert Kilometer kürzer war als gedacht. Nun heißt es, er messe 1233 Kilometer; das wäre sogar um 12 Kilometer kürzer als die Elbe, wenn man als deren Quelllauf die längere Moldau ansetzt und damit auf 1245 Kilometer kommt. Damit wäre die Elbe nicht mehr als die Nummer zwei unter den deutschen Strömen abqualifiziert, sondern die strahlende Erste.
Die Donau ist natürlich noch viel länger, fast dreitausend Kilometer. Aber sie stellt keinen eigentlich deutschen Strom dar, sondern entspringt hier nur, um dann neun weitere Staaten zu berühren und sich ins Schwarze Meer zu ergießen, wo Europa in Asien übergeht. Die Elbe und der Rhein hingegen haben gemeinsam, dass sie rein deutsche Flüsse wo nicht sind, so doch waren, und wo nicht rein deutsch, so doch innerhalb jenes Gebildes verliefen, das fast ein Jahrtausend lang das Heilige Römische Reich hieß (erst spät mit dem Zusatz «Deutscher Nation»). Heute ist der Rhein ein internationaler Fluss, er...
| Erscheint lt. Verlag | 14.5.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |
| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |
| Schlagworte | Bauhaus • Berlin • Böhmen • Brandenburg • DDR • Dessau • Deutsche Gegenwart • Deutschland • Dresden • Elbe • Fluss • Fluss Biographie • Geschichte • Gesellschaft • Halle • Hamburg • Kultur • Kulturlandschaft Deutschland • Leipzig • Leuna • Lutherstadt • Magdeburg • Meißen • Merseburg • Moldau • Naumburg • Ostdeutschland • Porträt Ostdeutschland • Reise • Rhein • Saale • Sachbuch Geschichte • Sachsen • Sachsen-Anhalt • Sächsische Schweiz • Tschechien • Unstrut • Wiedervereinigung • Wittenberg • Wörlitz • Zeitgeschichte |
| ISBN-10 | 3-644-01897-9 / 3644018979 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01897-6 / 9783644018976 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich