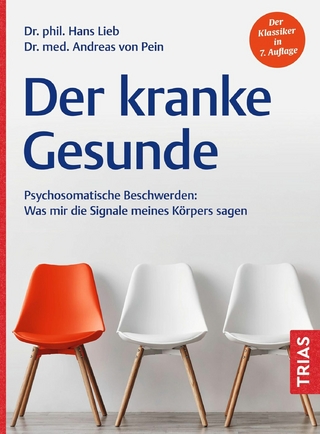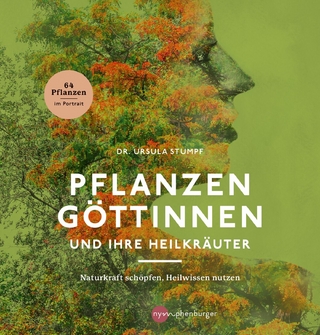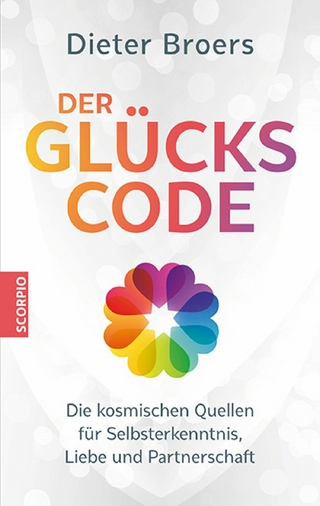KAFKA (eBook)
160 Seiten
Haymon (Verlag)
978-3-7099-7115-4 (ISBN)
Jürg Amann, geboren 1947 in Winterthur/Schweiz, lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2013 in Zürich. Studium der Germanistik in Zürich und Berlin, Literaturkritiker und Dramaturg, seit 1976 freier Schriftsteller. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Ingeborg-Bachmann-Preis, Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis. Bei Haymon: 'Zwei oder drei Dinge'. Novelle (1993), 'Über die Jahre'. Roman (1994), 'Und über die Liebe wäre wieder zu sprechen'. Gedichte (1994), 'Schöne Aussicht'. Prosastücke (1997), 'Kafka'. Wort-Bild-Essay (2000), 'Am Ufer des Flusses'. Erzählung (2001), 'Mutter töten'. Prosa (2003), 'Übermalungen. Überspitzungen'. Van-Gogh-Variationen (zus. mit Urs Amann, 2005), 'Zimmer zum Hof'. Erzählungen (2006), 'Nichtsangst'. Fragmente auf Tod und Leben (2008) und 'Die Reise zum Horizont'. Novelle (2010). Zuletzt erschien sein Roman 'Wohin denn wir' (2012). A. T. Schaefer geboren 1944 in Westfalen, Malerei- und Designstudium, seit 1981 Arbeit mit dem Medium Fotografie. Zahlreiche Ausstellungen und Bücher, zuletzt: Orte der Farbe (1996), Wagner und Venedig (1997), Das Waldhaus (1998), 10 Jahre Oper Stuttgart (2000) Bei Haymon: Kafka. Wort-Bild-Essay (gemeinsam mit Jürg Amann, 2000), Nietzsche. Süden (2000).
Jürg Amann, geboren 1947 in Winterthur/Schweiz, lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2013 in Zürich. Studium der Germanistik in Zürich und Berlin, Literaturkritiker und Dramaturg, seit 1976 freier Schriftsteller. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Ingeborg-Bachmann-Preis, Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis. Bei Haymon: "Zwei oder drei Dinge". Novelle (1993), "Über die Jahre". Roman (1994), "Und über die Liebe wäre wieder zu sprechen". Gedichte (1994), "Schöne Aussicht". Prosastücke (1997), "Kafka". Wort-Bild-Essay (2000), "Am Ufer des Flusses". Erzählung (2001), "Mutter töten". Prosa (2003), "Übermalungen. Überspitzungen". Van-Gogh-Variationen (zus. mit Urs Amann, 2005), "Zimmer zum Hof". Erzählungen (2006), "Nichtsangst". Fragmente auf Tod und Leben (2008) und "Die Reise zum Horizont". Novelle (2010). Zuletzt erschien sein Roman "Wohin denn wir" (2012). A. T. Schaefer geboren 1944 in Westfalen, Malerei- und Designstudium, seit 1981 Arbeit mit dem Medium Fotografie. Zahlreiche Ausstellungen und Bücher, zuletzt: Orte der Farbe (1996), Wagner und Venedig (1997), Das Waldhaus (1998), 10 Jahre Oper Stuttgart (2000) Bei Haymon: Kafka. Wort-Bild-Essay (gemeinsam mit Jürg Amann, 2000), Nietzsche. Süden (2000).
3. F. wie Fall
Am 14. August 1913 finden wir in Kafkas Tagebuch verzeichnet: »Folgerungen aus dem ›Urteil‹ für meinen Fall. Ich verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr. Georg geht aber an der Braut zugrunde.« (T. 226)
Soll das heißen: »Im Gegensatz zu mir, der ich an ihr nicht zugrunde gehen werde, insofern hat die Dichtung nichts mit mir zu tun«? Oder ist es schon Ausdruck des stillen Einverständnisses mit dem Notwendigen? – Klar ist: Kafka verdankt die Geschichte »ihr«. So wie »Das Urteil« am Anfang seines gültigen Werkes steht, so steht Felice am Beginn seiner gültigen Frauenbeziehungen, mehr noch, sie prägt, genau wie die erste Erzählung, die Form der folgenden. Kafka hatte Felice Bauer am 13. August 1912 anläßlich eines abendlichen Besuches bei seinem Freund Max Brod ganz zufällig kennengelernt, als es darum ging, die Blätter zu seinem Erstling »Betrachtung« endgültig zu ordnen. Anschließend hatte er sie noch zu ihrem Hotel begleitet, zusammen mit Brods Vater; sie war ja Berlinerin und nur auf der Durchreise. Nichts war an diesem Abend vorgefallen, außer daß es Kafka gelungen war, ihr das Versprechen zu einer gemeinsamen Palästinareise abzulocken11, und man weiß ja, was von solchen leichthin gegebenen Versprechungen über den Tisch hinweg gerade bei derartigen Zufallsbekanntschaften im allgemeinen zu halten ist. Für Kafka war es aber offenbar genug, und Elias Canetti hat wohl recht, mit der Art und Weise, wie er diese Abmachung kommentiert: »Er empfindet diesen Handschlag wie ein Gelöbnis, das Wort Verlobung birgt sich nah dahinter, und ihn, der so langsam von Entschluß ist, dem jedes Ziel, auf das er zugehen möchte, sich durch tausend Zweifel entfernt statt sich zu nähern, muß Raschheit faszinieren. Das Ziel des Versprechens aber ist Palästina, und schwerlich möchte es zu diesem Zeitpunkt seines Lebens ein verheißungsvolleres Wort für ihn geben, es ist das gelobte Land.« (C. 9 f.)
Es bedeutete für ihn die erste »Stufe jener Treppe, auf deren Höhe mir als Lohn und Sinn meines menschlichen (dann allerdings nahezu napoleonischen) Daseins das Ehebett ruhig aufgeschlagen wird« (B. 161). Als er das Mitte September 1917 an Max Brod schrieb, war allerdings das Unternehmen Felice schon endgültig in die Binsen gegangen, und Kafka hatte inzwischen längst eingesehen, daß er nie über diese erste Stufe hinauskommen würde. Im Tone unerschütterlicher Einsicht fügte er denn auch, halb schmerzlich, halb abgeklärt, hinzu: »Es wird nicht aufgeschlagen werden und ich komme, so ist es bestimmt, nicht über Korsika hinaus.« (B. 161)
Aber greifen wir nicht vor. Zunächst schien sich ihm mit diesem Handschlag am 13. August 1912 eine Welt, das Leben aufzutun. Launig vertraut er seinem Freund schon in der Frühe des nächsten Tages an: »Guten Morgen! Lieber Max, ich stand gestern beim Ordnen der Stückchen unter dem Einfluß des Fräuleins, es ist leicht möglich, daß irgendeine Dummheit, eine vielleicht nur im Geheimen komische Aufeinanderfolge dadurch entstanden ist.« (B. 102) – Ins Tagebuch hält das »Fräulein« mit der Bemerkung: »Viel an – was für eine Verlegenheit vor dem Aufschreiben von Namen – F. B. gedacht« (T. 202 f.), am 15. August schüchternen Einzug, um bald darauf darin die beherrschende Stellung einzunehmen. Eine Woche nach dem ersten und vorerst für lange Zeit einzigen Zusammentreffen, am 20. August 1912, finden wir ein erstes Porträt aus der noch frischen Erinnerung:
»Fräulein F. B. Als ich am 13. August zu Brod kam, saß sie bei Tisch und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. Ich war auch gar nicht neugierig darauf, wer sie war, sondern fand mich sofort mit ihr ab. Knochiges leeres Gesicht, das seine Leere offen trug. Freier Hals. Überworfene Bluse. Sah ganz häuslich angezogen aus, trotzdem sie es, wie sich später zeigte, gar nicht war. (...) Fast zerbrochene Nase, blondes, etwas steifes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum erstenmal genauer an, als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil.« (T. 204)
Kein sehr günstiges eigentlich, wie es scheint, wenn man aus der Summe der Details ein Bild vor seinen Augen malt. Fast zerbrochene Nase, reizloses Haar, starkes Kinn: kaum Eigenschaften, die einer Liebe auf den ersten Blick förderlich scheinen. Erschreckend vor allem und erstaunlich zugleich – erschreckend sein Vorhandensein, erstaunlich und erschreckend sein gnadenlos sachliches Festgestelltwerden -: das leere Gesicht ...
Endlich, am 20. September 1912, als er bei der Empfängerin längst vergessen sein mußte, richtet sich Kafka mit einem Brief persönlich an dieses leere Gesicht und beginnt, indem er es offen auf sich bezieht, es mit Inhalt zu füllen. Damit öffnet sich der Vorhang vor einem Drama in fünf Jahren, zu einem Kampf, der in erster Linie auf dem Papier und mit der Feder und – was vielleicht das Tragischste daran ist – mindestens von Kafkas Seite auch letztlich für das Papier und für die Feder geführt wurde.
»... ich kann nicht glauben, daß in irgendeinem Märchen um irgendeine Frau mehr und verzweifelter gekämpft worden ist als um Dich in mir, seit dem Anfang und immer von neuem und vielleicht für immer.« (F. 730) Das schreibt Kafka einmal im Laufe dieses ungleichen Schlagabtausches. Und mag er selbst vielleicht seiner eigenen rhetorischen Überzeugungskraft auf den Leim gegangen sein, so verrät sich eben doch die Sprache selbst. Das Wort, das gerade die Einzigartigkeit der inneren Auseinandersetzung betonen soll, entdeckt die tiefere Wirklichkeit des Märchens: um »irgendeine« Frau wird hier gekämpft, nicht um der Frau, nur um des Kampfes willen, eines Kampfes außerdem, in dem der Ausgang von vornherein feststeht.
»Letzthin die Vorstellung«, schreibt Kafka noch vier Jahre nach Beendigung dieses einen langen Kampfes, als es längst um eine andere Frau geht, am 2. Dezember 1921 in sein Tagebuch, »daß ich als kleines Kind vom Vater besiegt worden bin und nun aus Ehrgeiz den Kampfplatz nicht verlassen kann, alle die Jahre hindurch, trotzdem ich immer wieder besiegt werde.« (T. 396)
Ein Scheingefecht also, auf über 700 gedruckten Briefseiten. Kafkas Briefe an Felice, nach Canettis Urteil »die genaueste Geschichte einer Beziehung, die es überhaupt gibt« (C. Klappentext), »haben«, wie Erich Heller, der zusammen mit Jürgen Born für die Herausgabe verantwortlich zeichnet, zu ihrer Einleitung schreibt, »mit den Gesängen der Minnesänger das gemeinsam, daß die Besungene nicht ›wirklich‹ gefreit wird« (F. 33). – Nur so, aus dieser Unwirklichkeit der Werbung – und das ist wohl eine ihrer versteckten teuflischen Absichten –, läßt sich ihre Dauer auch nur einigermaßen erklären. Wo nur um der Werbung als solcher willen geworben wird, muß es ja geradezu im Interesse des Freiers liegen, nicht erhört zu werden und sogar mit allen – wenn nötig winkeladvokatorischen – Kniffen einer Erfüllung seiner vorgegebenen Sehnsucht entgegenzuwirken. Solange es eben geht. Und man wundert sich, bei seiner sonstigen Schwäche, über Kafkas Zähigkeit gerade in diesem Punkt und darüber, wie lange es eben tatsächlich ging.
Die äußeren Daten dieser Leidensgeschichte, die der Leidende nicht erlitt, sondern schrieb – er war ja Dichter – sind schnell genannt12. Sie seien vorweggenommen, damit bei der späteren Darstellung des Musters, das sich in ihr ausprägt und durch das sie geprägt wird, möglichst auf störende Details verzichtet werden und der innere Raum trotzdem auf den Hintergrund seiner Zeit projiziert werden kann.
Mit der Zufallsbegegnung bei Brods in Prag am 13. August 1912 begann es also. – Fünf Wochen später, am 20. September, rief sich Kafka mit einem ersten Brief nach Berlin bei Felice Bauer wieder in Erinnerung, einem Brief, den er vielleicht noch in der Tasche trug, als er in der Nacht vom 22. auf den 23. September die Geschichte hinwarf, die er »ihr« (T. 226) verdankte, die stilistisch seinen Durchbruch brachte, inhaltlich im visionär über sich selbst heraufbeschworenen Todesurteil zum ersten Mal die Wunde aufbrechen ließ, die sich nie mehr schließen, sondern zu jenem Wundkanal ausweiten sollte, in dem jeder neue Schmerz auf und ab fuhr, »schrecklich wie am ersten Tag« (S. 36). – Am 28. September erhielt Kafka erste Post aus Berlin13, die ihn dazu veranlaßte, noch am selben Tag zu antworten. Es folgte eine dreiwöchige, ungeduldig verbrachte Wartezeit14, bis endlich das erlösende Schreiben eintraf, am 23. Oktober, in dem die ferne Unbekannte ihre Bereitschaft zu weiterem Verkehr anzeigte. – Kafka reagierte stürmisch, unbeherrscht, noch am Empfangstag, und erzwang in der Folge beinahe despotisch einen möglichst regelmäßigen täglichen Briefaustausch, dessen Hauptthema allerdings die absolute Notwendigkeit dieser Regelmäßigkeit selbst...
| Erscheint lt. Verlag | 6.12.2013 |
|---|---|
| Verlagsort | Innsbruck |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Esoterik / Spiritualität | |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik | |
| Schlagworte | Briefwechsel • Das Urteil • Die Verwandlung • Enttarnung • Felice Bauer • Franz Kafka • Geheimnis • Lebenswerk • Maske • Phänomen Kafka • Vater Sohn Konflikt |
| ISBN-10 | 3-7099-7115-2 / 3709971152 |
| ISBN-13 | 978-3-7099-7115-4 / 9783709971154 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich