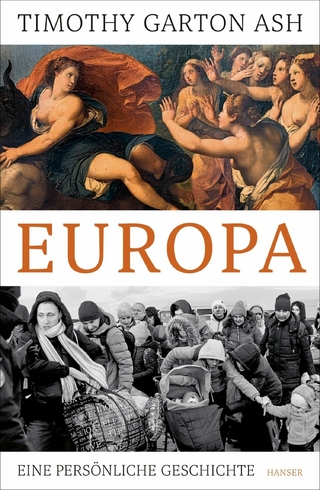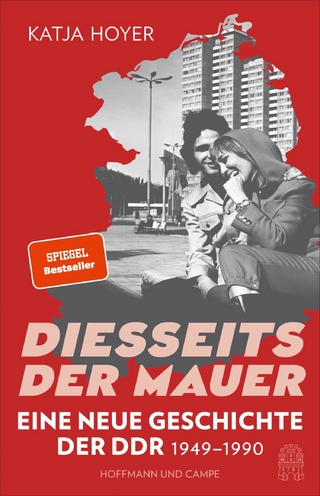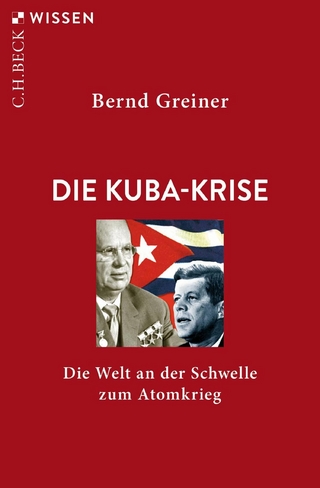Der 8. Mai (eBook)
224 Seiten
Das Neue Berlin (Verlag)
978-3-360-50139-4 (ISBN)
Alexander Rahr, 1959 in Taipeh in einer russischen Emigrantenfamilie geboren und in Tokio, Frankfurt und München aufgewachsen, ist ein Historiker, Politikberater und Publizist. Er ist Forschungsdirektor beim Deutsch-Russischen Forum in Berlin/ Moskau, EU-Berater der Gazprom, Stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Russischen Wirtschaft in Deutschland, Mitglied des Petersburger Dialogs, des internationalen Netzwerkes Valdai-Klub und Senior Fellow am WeltTrends Institut für Internationale Politik. Er ist Ehrenprofessor an der Moskauer Staatsuniversität für Internationale Beziehungen und an der Hochschule für Ökonomie, Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Freundschafts-Ordens Russlands. Er hat zahlreiche Bücher über Russland veröffentlicht. Von 1994-2012 leitete er das Russland/Eurasien Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wladimir Sergijenko, geboren 1971 in Lvov (heute Ukraine), Autor, Herausgeber, aktiv im internationalen PEN; Kurator und Organisator internationaler Kulturprojekte. Seit 1991 lebt er in Deutschland. Gründer der Diskussionsrunde 'Dialog statt Monolog' unter Schriftstellern für Völkerverständigung. TV- und Radio-Moderator in Russland.
Alexander Rahr, 1959 in Taipeh in einer russischen Emigrantenfamilie geboren und in Tokio, Frankfurt und München aufgewachsen, ist ein Historiker, Politikberater und Publizist. Er ist Forschungsdirektor beim Deutsch-Russischen Forum in Berlin/ Moskau, EU-Berater der Gazprom, Stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Russischen Wirtschaft in Deutschland, Mitglied des Petersburger Dialogs, des internationalen Netzwerkes Valdai-Klub und Senior Fellow am WeltTrends Institut für Internationale Politik. Er ist Ehrenprofessor an der Moskauer Staatsuniversität für Internationale Beziehungen und an der Hochschule für Ökonomie, Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Freundschafts-Ordens Russlands. Er hat zahlreiche Bücher über Russland veröffentlicht. Von 1994-2012 leitete er das Russland/Eurasien Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wladimir Sergijenko, geboren 1971 in Lvov (heute Ukraine), Autor, Herausgeber, aktiv im internationalen PEN; Kurator und Organisator internationaler Kulturprojekte. Seit 1991 lebt er in Deutschland. Gründer der Diskussionsrunde "Dialog statt Monolog" unter Schriftstellern für Völkerverständigung. TV- und Radio-Moderator in Russland.
Befehlsverweigerung
Am Morgen des 8. Mai liest Leutnant Stefan Doernberg vom Stab der 8. Gardearmee in einer Druckerei in Berlin-Schöneweide Korrektur für eine kleine, vier Seiten umfassende Zeitung. Seit dem Ende der Kampfhandlungen in Berlin geben Doernberg und einige Offiziere seiner Einheit dieses Blatt mit Nachrichten über die Situation in Berlin und die letzten Tage des Krieges heraus und verteilen es an die Bevölkerung. Dort in der Druckerei erreicht ihn am frühen Vormittag die Anweisung, zusammen mit anderen Offizieren ein Tonaufzeichnungsgerät aus dem Funkhaus in der Masurenallee nach Karlshorst zum Stab des Militärkommandanten von Berlin, General Bersarin, zu bringen. Wozu das Gerät gebraucht wird, erfahren sie nicht.
—
Ich gehörte zu den deutschen Emigranten, die in den Reihen der Streitkräfte der Staaten der Anti-Hitler-Koalition als Freiwillige am Kampf für die Befreiung der europäischen Völker, damit auch des deutschen Volkes von der faschistischen Barbarei teilgenommen haben. Insgesamt waren es nur wenige Deutsche, die in dieser Form ihren bescheidenen Beitrag im antifaschistischen Krieg geleistet hatten. Es war auch ein Abschnitt des deutschen Widerstands, zweifellos nicht der wichtigste. Er darf nicht überschätzt, wenn auch nicht vergessen werden.
Mir wurde ein doppeltes Glück zuteil. Ich wurde nicht wie so viele ein Opfer dieses schrecklichen Krieges und erlebte sein Ende noch dazu in Berlin, dort, wo ich 21 Jahre vorher das Licht der Welt erblickt hatte.
Am 21. Juni 1941, einem Samstag, feierte ich mit Schulfreunden meinen 17. Geburtstag. Wir gingen in den nahegelegenen Gorki-Park an der Moskwa. Hier erfuhren wird von der Radiorede Molotows, der in großer Erregung erklärt hatte, Deutschland habe im Morgengrauen ohne Kriegserklärung die UdSSR überfallen und viele Städte bombardiert. Ich eilte sofort zum Wehrkommando unseres Stadtbezirks. Dort wartete bereits eine lange Schlange jüngerer wie älterer Männer, die sich – wie ich – unaufgefordert zum Fronteinsatz meldeten. Bereits eine Woche nach meiner Meldung befand ich mich auf dem Weg ins Frontgebiet. Ich gehörte einer vom Moskauer Jugendverband aufgestellten Brigade von Freiwilligen an. Wir sollten die Pioniertruppen der Armee beim Errichten von Befestigungsanlagen unterstützen. … Unsere Brigade kehrte Anfang August nach Moskau zurück. … Mitte Dezember 1941 – die Abwehrschlacht um Moskau war bereits entbrannt – erhielt unsere Familie die lakonische Nachricht, dass wir in ein Dorf umziehen sollten. Mit uns wurden weitere Ausländer, nicht nur Deutsche, dorthin verbracht. Das war eine Art Internierung, genauer gesagt: Verbannung. … Erneut bemühte ich mich um einen Fronteinsatz. … Im Januar 1942 erhielt ich Aufforderung, mich mit meinen Papieren und kleinem Gepäck im Kommando zu melden. Man übergab mir eine Fahrkarte und einen versiegelten Brief, den ich in der Dienststelle abgeben sollte. Allerdings handelte es sich nicht, wie ich angenommen hatte, um eine Ausbildungseinheit. Es war ein Internierungslager für Sowjetdeutsche. … So begann ich mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, am Rand von Sibirien bis zum Kriegsende bleiben zu müsssen. Auch das nahm ich mit einer gewissen Gelassenheit hin, weil ich den Sieg nahe wähnte. Stalin hatte ja in seinem Tagesbefehl zum 1. Mai die Weisung ausgegeben, den Krieg noch 1942 siegreich zu beenden. Möglicherweise rechnete er auch mit einer von den Alliierten vage versprochenen zweiten Front im Westen. Im Sommer jedoch rückte die Wehrmacht bis zur Wolga vor. … Völlig unverhofft wurde ich an einem warmen Junitag 1942 zum Chef des Lagers gerufen. Er eröffnete mir, dass aus Moskau die Anweisung zu meiner Entlassung gekommen sei, er entschuldigte sich sogar für die Internierung, es sei eine Fehlentscheidung gewesen, im Krieg komme so etwas leider vor. In Moskau traf zwei, drei Wochen später ein Telegramm ein, die Leitung der Komintern forderte mich auf, nach Ufa zu kommen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass mich die Exilleitung der KPD an die Parteischule der Komintern delegiert habe. … Das Ziel des Ein-Jahres-Lehrgangs war klar definiert: Wir sollten im antifaschistischen Kampf und beim Aufbau eines neuen, demokratischen Deutschland eingesetzt werden. Wo und wie das geschehen sollte, sagte uns jedoch niemand. … Im August 1943 kehrte ich mit anderen Absolventen nach Moskau zurück. Einige sollten die Arbeit des im Juli in Krasnogorsk gegründeten Nationalkomitees »Freies Deutschland« unterstützen, anderen, darunter mir, wurde vorgeschlagen, als Soldat ins Feldheer der Roten Armee zu gehen. Mit Freuden stimmte ich zu. …
Mit der 8. Gardearmee führte mich der schwere Weg des Krieges durch die Ukraine, Belorussland und Polen bis Berlin. Ich war der Jüngste in der 7. Abteilung und brachte es bis zum Leutnant. Zu meinen Aufgaben gehörte es, Flugblätter zu verfassen und ihren Druck in unserer Felddruckerei, einem Lkw, zu überwachen – die Drucker sprachen kein Deutsch. Daneben gab es Einsätze mit Lautsprecherwagen an unserer vordersten Linie. In der Regel begannen wir mit dem Abspielen einer Schallplatte – deutsche Volkslieder oder Schlager, die bei den Soldaten sehr beliebt waren. Danach wurden aktuelle Nachrichten oder politische Appelle verlesen. Zu meinen Obliegenheiten gehört es, die Texte zu entwerfen oder ins Deutsche zu übersetzen. Oft sprach ich auch selbst. Selten gelang uns ein Einsatz ohne Feindbeschuss, wir hatten Verletzte und auch Tote zu beklagen.
Zwischen der Seelower Schlacht und der Einnahme von Berlin lagen zwei Wochen. In meinem Gedächtnis erscheinen sie mir als die längsten vierzehn Tage meines Lebens. Unmittelbar nach den Kämpfen von Seelow wurde ich mit unserer Lautsprecheranlage an der Hauptkampflinie nordwestlich von Müncheberg eingesetzt. Dort erhielt ich den Befehl, mich unverzüglich beim Reserveregiment des Armeeoberkommandos zu melden. Eine Kommission zur Überprüfung der Offizierskader wäre unlängst aus Moskau gekommen. Ein Deutscher könne nicht in der Politabteilung der Armee geduldet werden, hätte sie entschieden. Ich war nicht bereit, mich so kurz vor Kriegsende in die Etappe abschieben zu lassen und verweigerte den Gehorsam. Ich wollte bei der Befreiung meiner Vaterstadt dabeisein. Der General, dem meine Abteilung unterstand, stimmte wenigstens meinem Vorschlag zu, zur Politverwaltung der Frontgruppe von Marschall Shukow zu fahren. Sie befand sich noch in Landsberg an der Warthe, etwa 100 Kilometer ostwärts. Ich hatte gehört, dass sich dort der Leiter der 7. Abteilung an der Front, General Burzew, aufhielt, der bei dem Gespräch 1943 in Moskau dabei war, als über meinen Fronteinsatz entschieden wurde. Es gelang mir, in Landsberg bis zu ihm vorzudringen und mein Problem vorzutragen. Burzew versprach mir, sich umgehend mit meiner Diensteinheit in Verbindung zu setzen, um die Entscheidung der Kaderkommission als ungültig zu erklären. Die Befehlsverweigerung hätte schlimm ausgehen können, so aber kehrte ich in meine Abteilung zurück, die inzwischen in Vogelsdorf, kurz vor Berlin, lag, und erstattete Meldung über meine Audienz bei General Burzew. Damit war das Thema erledigt. Am nächsten Tag zog unsere Einheit nach Schöneiche – nach zehn Jahren betrat ich wieder Berliner Boden.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges, vor allem die letzten Tage der harten Häuserkämpfe in Berlin, werde ich nie vergessen. Es war dabei ein gemischtes Gefühl. Zum einen war ich natürlich überzeugt, dass dieser furchtbare Krieg in wenigen Tagen enden müsste. Zum anderen aber konnte ich mir nicht vorstellen, dass man schon am nächsten oder übernächsten Tag inmitten dieser Trümmerstadt in einem friedlichen Berlin, also ohne ständigen Kanonendonner und peitschende MG-Garben aufwachen würde. Zum Grübeln über die Zukunft hatte ich jedoch kaum Zeit.
Am frühen Morgen des 2. Mai wurde ich zum Gefechtsstand des Befehlshabers der 8. Gardearmee Generaloberst Wassili Tschuikow beordert. Dort war der Chef des Verteidigungsbereichs Berlin, der Wehrmachtsgeneral Weidling eingetroffen, der sich zur Kapitulation der deutschen Truppen in der Reichshauptstadt bereit erklärt hatte. Nicht ohne Aufregung tippte ich seinen Befehl auf einer Schreibmaschine mit deutscher Schrift, die ich dazu mitgebracht hatte. Etwas merkwürdig empfand ich den ersten Satz dieses ansonsten historisch bedeutsamen Dokuments. »Am 30.4.45 hat sich der Führer selbst entleibt und damit uns, die wir ihm die Treue geschworen hatten, im Stich gelassen.«
Das sollte also die wichtigste Begründung für die folgende leider viel zu späte Feststellung sein: »Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt seine Opfer umsonst.« Dann aber erfolgte die letztendlich richtige Aufforderung, sofort den Kampf einzustellen. Und das war schließlich das Wichtigste. Gemeinsam mit einem Offizier aus Weidlings Stab verkündete ich über unseren Lautsprecherwagen den Befehl zur Kapitulation an mehrere Einheiten, zu denen Weidling in der damaligen Situation bereits keine Verbindung mehr hatte. Fast 90000 Soldaten und Offiziere, darunter einige Generale, gaben sich bis zum Nachmittag gefangen. Niemand hatte erwartet, dass noch so viele den Durchhaltebefehlen gefolgt waren.
Die in Weidlings letztem Befehl enthaltene Mitteilung über den Selbstmord Hitlers war für mich schon keine sensationelle Nachricht, hatte ich doch davon bereits am Vortag erfahren. Es hatte sich so ergeben, dass ich als einer von mehreren Dolmetschern teilweise Zeuge von Verhandlungen wurde. In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai war General Hans Krebs, seit kurzem Chef des deutschen Generalstabs, als Parlamentär auf dem Gefechtsstand von Generaloberst Tschuikow erschienen. Er befand sich zwischen dem Flugplatz Tempelhof und dem...
| Erscheint lt. Verlag | 30.4.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | 2. Weltkrieg • 8. Mai 1945 • Alexander Rahr • Befreiung vom Faschismus • Berichte • Berlin • Churchill • Deutsche Geschichte • Deutschland • Eisenhower • Erlebnisberichte • Führer • historischer Tag • Hitler • Kapitulation • Schukow • Siegermächte • Stalin • Tag der Befreiung • Truman • Wehrmacht • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-360-50139-X / 336050139X |
| ISBN-13 | 978-3-360-50139-4 / 9783360501394 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich