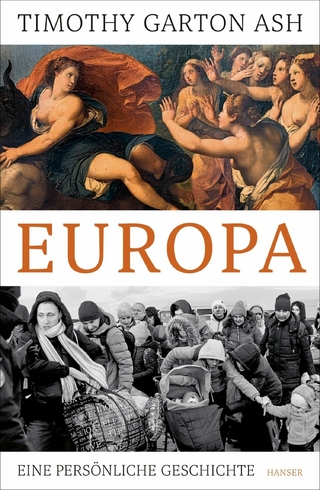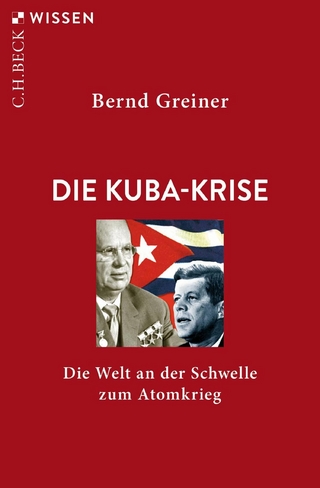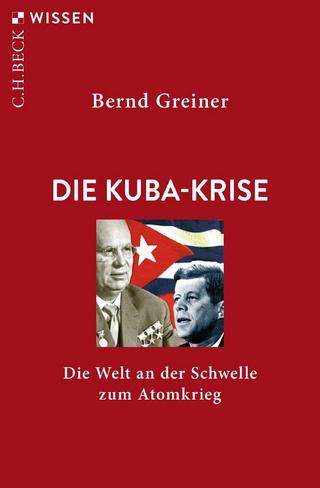Die kurze Stunde der Frauen (eBook)
256 Seiten
Verlag Herder GmbH
978-3-451-83182-9 (ISBN)
Miriam Gebhardt ist Journalistin und Historikerin und lehrt als außerplanmäßige Professorin Geschichte an der Universität Konstanz. Sie ist häufig eingeladene Interviewpartnerin sowohl im Fernsehen als auch im Rundfunk sowie in Printmedien und überdies dem deutschen Publikum aus vielen Fernsehdokumentationen bekannt. Neben ihrer journalistischen Arbeit, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und verschiedene Frauenzeitschriften, habilitierte sie sich mit einer Arbeit über die Deutschen und ihre Kinder ('Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert', 2009). Miriam Gebhardt ist Autorin mehrerer Bücher, darunter 'Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet' (2011) sowie 'Alice im Niemandsland. Wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor' (2012). Ihr Bestseller 'Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs' (2015) wurde breit besprochen und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zuletzt von ihr erschienen: 'Unsere Nachkriegseltern. Wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen' (2022). Miriam Gebhardt lebt in Ebenhausen bei München.
Miriam Gebhardt ist Journalistin und Historikerin und lehrt als außerplanmäßige Professorin Geschichte an der Universität Konstanz. Sie ist häufig eingeladene Interviewpartnerin sowohl im Fernsehen als auch im Rundfunk sowie in Printmedien und überdies dem deutschen Publikum aus vielen Fernsehdokumentationen bekannt. Neben ihrer journalistischen Arbeit, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und verschiedene Frauenzeitschriften, habilitierte sie sich mit einer Arbeit über die Deutschen und ihre Kinder ("Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert", 2009). Miriam Gebhardt ist Autorin mehrerer Bücher, darunter "Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet" (2011) sowie "Alice im Niemandsland. Wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor" (2012). Ihr Bestseller "Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs" (2015) wurde breit besprochen und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zuletzt von ihr erschienen: "Unsere Nachkriegseltern. Wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen" (2022). Miriam Gebhardt lebt in Ebenhausen bei München.
Vorwort: Die kurze Stunde der Frauen
Als Luise Stieber im Jahr 1944 erfährt, dass ihr Mann an der Front vermisst wird, legt sie ein Tagebuch für ihn an. Er soll später einmal nachlesen können, wie es seiner Frau und den zwei Kindern am Bodensee in den letzten Kriegsjahren ergangen ist. Den Gedanken, er könnte gefallen sein, schiebt sie weit von sich. Sie beschließt, seinen Gärtnereibetrieb um jeden Preis am Leben zu erhalten. Die Pflanzen sollen sie miteinander verbinden, doch der Kraftaufwand ist immens. Der Betrieb wird gleich dreimal von Bomben zerstört. Sie verliert ihre Wohnung. Das erste Ausweichquartier muss sie mit Wehrmachtssoldaten teilen, das zweite mit den Amerikanern. Von der Verwandtschaft kommt keine Hilfe, die Konkurrenz will ihr die Anbauflächen abjagen, und die Bank verweigert den Kredit für neue Glashäuser. Das Unternehmen habe schließlich keinen Chef mehr. Auch die Kinder überfordern sie ohne die Autorität eines Vaters. Der Sohn muss zwischendurch ins Heim. Immer wieder schreibt Luise Stieber: »Das ist fast zu viel für eine Frau.« »Ich verkrafte das nicht mehr.« »Ich bin keine Natur zum selbstständig Handeln und bin nun doch gezwungen dazu.« Die Anfang Vierzigjährige wird krank vor Erschöpfung, doch immer wenn sie aufgeben möchte, denkt sie an ihr großes Ziel: ihren Mann mit ihrem Einsatz für seine Gärtnerei zu überraschen, wenn er zurückkehrt. Drei lange Jahre kämpft sie, dann verändert sich ihre Tonlage. Sie merkt, dass sie inzwischen etwas von dem Geschäft versteht. »Allzu viel Lehrgeld muss ich nicht mehr bezahlen. Und bin unabhängig von allen. Stehe auf eigenen Füßen.«1 Erzählt uns Luise Stiebers Tagebuch also die Geschichte einer Emanzipation?
Ihr selbst wäre dieses Wort wohl nicht eingefallen. Sie versteht sich immer nur als die Frau des Gärtners, die in seinem Auftrag handelt. Was sie erlebt, ist für sie ein Schicksal, das ihr die Zeit aufgezwungen hat: die Notwendigkeit der Selbstermächtigung.
Wenn wir uns heute mit den Frauen der Nachkriegszeit beschäftigen, hören wir oft Heldinnengeschichten: Erst befreien sie mit bloßen Händen das Land von den Trümmern des Kriegs, dann tragen sie kraft ihrer reinen Herzen dazu bei, das Land von seiner moralischen Schuld zu reinigen. Nebenher retten sie ihre Angehörigen über die Hungerjahre, helfen der Ökonomie auf die Beine, ziehen die Kinder groß, und schlussendlich treten sie großzügig in die zweite Reihe zurück, damit ihre Männer wieder die erste Geige spielen können. Zur Belohnung erhalten sie, früher als Frauen in vielen anderen Ländern, die Gleichberechtigung. Das Jahr 1949, als die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik ihre Verfassungen verkünden, wird zugleich zum Stichjahr für die formale Gleichberechtigung von Frau und Mann in Deutschland. Zum ersten Mal gilt sie vorbehaltlos und uneingeschränkt. Das war mehr als ein Etappenziel, möchte man meinen.
Heute, zum 75. Jubiläum der Verfassungen in West und Ost, beschleichen mich allerdings Zweifel daran, wie nachhaltig dieser Schritt war. Denn wenn wir uns in der Zeitachse weiterbewegen, ist die kurze Stunde der Frauen bald vorbei. Die Politik verschleppt nach 1949 die geforderte Umsetzung der Gleichberechtigungsnorm. Es bedarf noch vieler Zwischenschritte, bis verheiratete Frauen überhaupt nur ein eigenes Konto eröffnen dürfen oder selbst entscheiden können, ob und wie viel sie arbeiten. Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft kehrt in den 1950er Jahren rasch zum bürgerlichen Ehemodell zurück, in dem der Mann arbeitet und die Frau höchstens etwas »dazuverdient«.
Die DDR macht zwar schneller Nägel mit Köpfen. Für den sozialistischen Staat ist die erwerbstätige Frau nämlich nicht nur ein wirtschaftliches Muss, sondern gehört auch zum ideologischen Auftrag des Kommunismus. Aber die Emanzipation bemisst sich im Osten einzig und allein an der Präsenz der Frauen in der Landwirtschaft und Industrie, nicht an der weiblichen Repräsentanz in den wirtschaftlichen und politischen Leitungsgremien oder an der partnerschaftlichen Aufgabenteilung im Haushalt und bei der Kindererziehung. Der Fortschritt bewegt sich auch hier im Krebsgang: hauptsächlich seitwärts und nur ein bisschen vorwärts.
Natürlich gibt es beiderseits des Eisernen Vorhangs Ausnahmeerscheinungen wie die furchtlose Unternehmerin und Kunstfliegerin Beate Uhse oder die Justizministerin Hilde Benjamin. Doch wo sind die vielen anderen abgeblieben? Was wurde aus den zahllosen Kämpferinnen der Frauenausschüsse, was aus den Medienschaffenden, die im Auftrag der Besatzungsmächte das Land demokratisieren sollten? Wir haben viel gehört von der sagenhaften Belastbarkeit der sogenannten Trümmerfrauen, aber warum landeten so viele von ihnen in der Müttererholung, und warum hängt dieser Generation heute der Ruf an, ihre Kinder wenig liebevoll und sich selbst mit ungeheurer Härte behandelt zu haben? Der aktuelle Hype um die Nachkriegsfrauen in Film, Buch und Feuilleton ist, wie mir scheint, vom realen Leben unserer Mütter und Großmütter doch noch ein ganzes Stück entfernt.
Auf eine Kurzform gebracht, werden die Nachkriegsfrauen heute für etwas gefeiert, für das sie damals ohnehin zuständig waren, nämlich die Bewältigung der Alltagsnot. Darüber sind die weniger schillernden Aspekte ihrer Geschichte offenbar unter den Tisch gefallen: ihre bodenlose Erschöpfung, die Zumutung (oder das Glück?), Arbeit und Verantwortung wieder abzugeben, als die Männer aus dem Krieg zurückkehrten, aber auch die spezifisch weiblichen Gewissensfragen im Nachgang des Nationalsozialismus. Der satt zufriedene Blick auf den angeblichen Glanz der »Trümmerfrauen« scheint die Widersprüche der damaligen Geschlechterordnung zu verdecken – vor allem die für uns heute so wichtige Frage: Wann und woran ist seit dem Neubeginn im Jahr 1949 die faire Verteilung von Arbeit und Leben, von Freiheit und Bindung denn gescheitert? An den Männern, an der Systemkonkurrenz oder an den weiblichen Bedürfnissen?
Mein persönliches Interesse an diesem Buch gilt dieser Frage. Einerseits waren die Frauen nach dem Krieg anscheinend bewunderungswürdige Pionierinnen der Frauenemanzipation, weil sie vorübergehend das Land wieder in Betrieb nahmen. Andererseits sind viele – freiwillig und unfreiwillig – rasch wieder von der Bildfläche verschwunden. Wie ging das vonstatten? Ich glaube nicht an das feministische Märchen, »das« Patriarchat habe den Frauen ihre Freiheiten wieder aus der Hand geschlagen. Ich gehe davon aus, gemeinsam geteilte Vorstellungen waren dafür verantwortlich, dass sich Frauen und Männer doch wieder auf ihre angebliche Wesensart besannen. Die Kirchen predigten Anstand und Fruchtbarkeit, das ließ nicht viel Spielraum bei der Suche nach neuen Rollen. Der Staat glorifizierte die sogenannten weiblichen Tugenden, und die westdeutsche Gesellschaft als Ganzes suchte das Heil in der bürgerlichen Familie. Deshalb gab es dort keine Infrastruktur für erwerbstätige Mütter. Und auch in der DDR konnten Frauen ihre Kinder erst sehr viel später in Tages- und Wochenheimen unterbringen, was ihnen zudem oftmals sehr wehtat. Welche Wahlmöglichkeiten hatten sie (und ihre Männer) unter diesen Umständen? Waren die sprichwörtliche Kälte der Erziehung der Nachkriegszeit, der oft fehlende Körperkontakt zwischen Eltern und Kind eine zwangsläufige Folge dieser Situation?
Der sogenannte Frauenüberschuss nach 1945 aufgrund der Gefallenen und der Kriegsgefangenen ließ es so aussehen, als könnten nicht alle Frauen einen Mann »abbekommen«. Deshalb ist die ikonisch gewordene Nachkriegsfrau alleinstehend. Gleichzeitig galt eine Frau ohne Mann recht bald als defizitäres Wesen. Es war einfach beschämend, ohne männlichen Begleitschutz in der Öffentlichkeit dastehen zu müssen. Im Restaurant konnte es vorkommen, dass eine einzelne Frau vom Ober abgewiesen wurde, bei der Wohnungssuche wurde sie benachteiligt, weil sie womöglich einen »unsittlichen Lebenswandel« führte, und »ledige Mütter« standen erst recht außerhalb des eingehegten Gartens bürgerlicher Sittlichkeit. Wie war also die Situation für eine verwitwete Frau anders zu lösen als durch eine schnellstmögliche neue Heirat? Es wäre schön zu glauben, was am 8. August 1947 zu diesem Thema im Frauenfunk des Bayerischen Rundfunks zu hören war: »Diesen neuen Frauentyp nennt man ›Junggesellin‹. Der Hauptunterschied zwischen einer alten Jungfer und einer nicht mehr jungen Junggesellin ist wohl, dass die alte Jungfer immer noch mit ihrem Schicksal hadert, während die Junggesellin sich in der Welt einrichtet, so gut es geht. Sie hat jedenfalls einen Beruf, ist unabhängig von der Fürsorge irgendwelcher Verwandten, hat ihre eigenen Freunde und Bekannten, denkt nicht immer, die andern Frauen hätten es besser, und hat möglichst auch ein eigenes Zuhause.«2 Doch gelang den Frauen dieser Akt der Selbstberuhigung?
Eine weitere Paradoxie fasziniert mich heute an den Nachkriegsfrauen: Sie gründeten damals zahllose politische Organisationen, glaubten sogar, die Zeit sei reif für reine Frauenparlamente, denn die Männer hätten durch Krieg und Nationalsozialismus abgewirtschaftet. Frauen kämpften für Frieden und gegen die Wiederbewaffnung, für die paritätische Teilhabe in der Politik und für gleiche Löhne. Doch die meisten Aktivistinnen stammten aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus, fanden keine jüngeren Nachahmerinnen und mussten erleben, dass ihre Politik als alltagspraktisches Gedöns verniedlicht wurde. Haben sie sich deshalb ins Private zurückgezogen?
Das Jahrzehnt nach 1945 war, das scheint mir bis hierhin...
| Erscheint lt. Verlag | 13.5.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Schlagworte | Alliierte • Alliierte Besatzung • Besatzungszone • Deutschland 1949 • doppelte Staatsgründung • Emanzipation • Frauen • Geschlechterrolle • Gewalt • Gründung der BRD • Gründung der DDR • Nachkriegszeit • Nationalsozialismus • Parlamentarischer Rat • Trümmerfrau • Vergewaltigung |
| ISBN-10 | 3-451-83182-1 / 3451831821 |
| ISBN-13 | 978-3-451-83182-9 / 9783451831829 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich