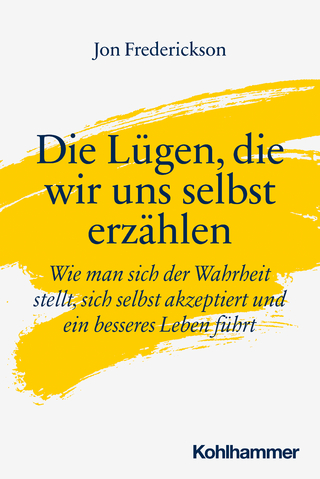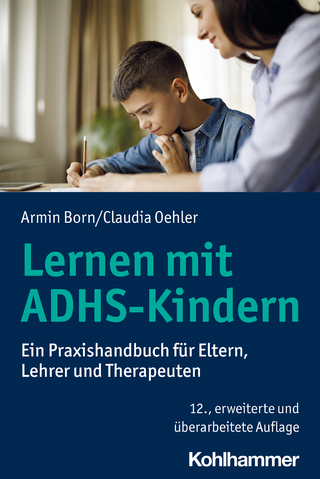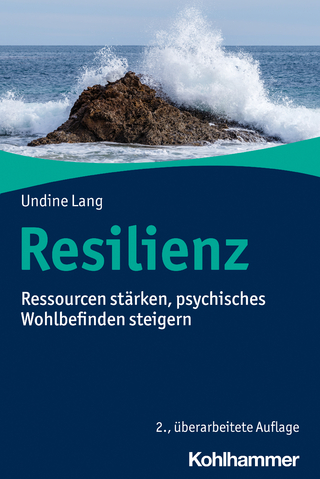"Sie Affe!" "Du Schwein!"
Heyne, W (Verlag)
978-3-453-60099-7 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Hans G. Raeth, geboren 1965, studierte Philosophie, Germanistik und Psychologie, arbeitete als Theaterkritiker und Marketingleiter. Seit 2004 ist er als freier Autor tätig. Hans G. Raeth lebt in Köln.
Warum der konstruktive Dialog im Arsch ist: ein konstruktives Plädoyer Liebe Leser, dieses Buch ist weniger ein rhetorischer Ratgeber und mehr eine lockere Auseinandersetzung mit der Frage, warum wir uns im täglichen Umgang mit Samthandschuhen anfassen, obwohl die Probleme, die wir zu verhandeln haben, eine deutliche Sprache verdient hätten. Diskussionen in Deutschland, gleichgültig, ob in den Medien, im Bundestag oder am Arbeitsplatz, sind von einer solch erschütternden Nüchternheit, dass wahrscheinlich viele jener Dichter und Denker, auf denen unser kultureller Nationalstolz fußt, uns als Volk von Memmen, Weicheiern und Warmduschern bezeichnen würden. Jedenfalls frage ich mich, warum wir unsere Sprache einzementieren und sie in Codes gießen. Warum wir eine Gelehrtensprache pflegen und eine Geschäftssprache, eine Privatsprache und eine Gesellschaftssprache. Warum nehmen wir im privaten Bereich kein Blatt vor den Mund und motzen über unhaltbare Zustände in allen erdenklichen Formen? »Das ist total scheiße! Du wolltest die Kinder heute abholen, du blöder Sack! Das hast du versprochen!« Während wir beispielsweise im Berufsleben an gleicher Stelle mit Begriffen wie »suboptimal«, »prozessabhängig« oder »anwendungsorientiert« jonglieren. Diese Sprachverwirrung hat Folgen. Ein Witz verdeutlicht, was ich meine: Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine »Ich hab in letzter Zeit ganz komische Sprachstörungen. Ich wollte kürzlich ein Ticket nach Bukarest kaufen, hab aber gesagt:>Rukabest»Geht mir ganz ähnlich«, erwidert sein Freund. »Ich saß kürzlich mit meiner Frau am Frühstückstisch und wollte eigentlich sagen:>Schatz? Reichst du mir mal bitte die Konfitüre rüber?Du dumme Schlampe hast mir mein Leben versautDer Volksmund sagt, wovon das Herz voll ist, davon kann der Mund nicht schweigen. Im gesellschaftlichen Umgang haben wir diese Maxime aufgegeben. Jede emotionale Äußerung wird als Angriff auf den sachlichen Diskurs gewertet. Und weil dieser als Königsklasse der Auseinandersetzung gilt, sind Gefühlsbekundungen per Definition zweitklassig. Im Privatleben hingegen riskieren wir für große Gefühle Kopf und Kragen, für die wahre Liebe setzen wir binnen kürzester Zeit unser Glück, unser Seelenheil und unsere Ersparnisse aufs Spiel, während wir den Abschluss einer Versicherung wochen- oder gar monatelang minutiös planen. Die Tatsache, dass emotionale Entscheidungen oft nicht minder tauglich sind als rationale, sollte uns ins Grübeln bringen. Die Entemotionalisierung unserer Streitkultur basiert aber vielleicht weniger auf einer generellen Skepsis emotionalen Entscheidungen gegenüber und mehr auf der Sorge, die Kontrolle über den sachlichen Dialog und damit über die Sachthemen selbst zu verlieren. Möglich, dass aber gerade dieser Kontrollverlust Kreativität freisetzt und neue Perspektiven ermöglicht. Beleidigungen als gesellschaftlich geächtete rhetorische Stilmittel gehören zu den schärfsten Waffen in einem Schlagabtausch. Zahlreiche Beispiele aus Geschichte und Gegenwart zeigen, dass die Beleidigung keineswegs automatisch kontraproduktiv ist. Eine witzige und treffende Verbalinjurie kann nicht nur eine Situation schlagartig verändern, sondern auch Mehrheiten und Machtverhältnisse beeinflussen. Einer der Gründe, warum sich Mächtige nur sehr ungern beleidigen lassen. Es gibt sogar Menschen, die die Funktion der Beleidigung als demokratisches Instrument des gewaltlosen Widerstandes für schützenswert halten. Eine belgische Initiative will die Beleidigung per UNESCO-Beschluss zum geistigen Kulturerbe der Menschheit erklären. Im »Manifest für den Schutz der Beleidigung« heißt es: »In einer Welt, in der der Kommunikation überragende Bedeutung zukommt, ist die Kontrolle der sprachlichen Standards von höchstem Interesse. Auch durch die Sprache werden Menschen ausgeschlossen und soziale Beziehungen aufgebaut. Die Beleidigung ist einer der derbsten sprachlichen Ausdrücke und einer der offensichtlichsten hinsichtlich der Machtverhältnisse.« Das mag auf den ersten Blick etwas überzogen klingen, wenn man sich aber Geschichte und Gegenwart der Beleidigung anschaut, dann wird man feststellen, da ist was dran. Die Kunst der Beleidigung ist nicht zu verwechseln mit dem schnöden Einsatz von Kraftausdrücken. Die gehören zwar dazu, sind aber nur das Salz in der Suppe. Vielmehr geht es um die Frage, ob Beleidigungen, wenn sie klug und zielsicher eingesetzt werden, die Bandbreite rhetorischer Mittel sinnvoll erweitern können. Sie merken bereits an der Formulierung, dass kunstvolle Beleidigungen mit Gefühlsausbrüchen wenig gemein haben. Beleidigungen emotionalisieren zwar einen Diskurs, was aber nicht bedeutet, das er damit irrational werden muss. Die Kunst der Beleidigung zielt darauf ab, den sachlichen Dialog mittels Stichelei und Provokation, mittels Spott und Häme, mittels Verballhornung und Verunglimpfung um die emotionale Dimension zu erweitern. Viele Beleidigungskünstler zeigen uns, wie das geht. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir bei einem Spaziergang über das Schlachtfeld der Verbalinjurie sowohl scharfzüngige Menschen treffen, deren Geschichte und Geschichten oft seltsame und komische Wendungen hatten, als auch weniger sprachbegabte Exemplare, die sich aber in Sachen Beleidigung trotzdem für nichts zu schade sind. Vom Profi-Pöbler bis zur drittklassigen Dreckschleuder, vom Familienkrach bis zur Ehekrise ist also alles dabei, und zwar quer durch die Jahrhunderte bis heute. Was ist? Haben Sie Lust? Dann schlendern wir doch mal los. Kanaillen, Kaiser, Könige Die Erfindung der Pöbelei: eine kleine Geschichte der Verbalinjurie. »Ich bin Vulkanier, ich habe kein Ego, das man kränken kann.« Captain Spock (Leonard Nimoy) in STAR TREK - DER ZORN DES KHAN Das mag wohl die erste Beleidigung der Menschheit gewesen sein? Ich vermute, es war eine Gebärde. Man tippte sich wahrscheinlich nicht mit dem Zeigefinger an den Kopf, weil noch niemand um dessen Bedeutung für das Denken wusste. Vielleicht aber assoziierte man den Anus bereits mit Dreck, Unflat, Scheiße. Womöglich streckte also ein Hominide einem anderen seinen behaarten Hintern entgegen, um dem Kollegen klarzumachen, wo er ihn mal könne. Oder brauchte es Sprache, um Beleidigungen möglich zu machen? Brauchte es obendrein ein zumindest rudimentäres Bewusstsein, um so etwas wie eine Beleidigung überhaupt als Angriff auf die eigene Person verstehen zu können? Fangen wir mal anders an: Können Tiere beleidigt sein und können Sie insofern auch beleidigt werden? Haustierbesitzer werden diese Frage vermutlich bejahen. Wenn man einen Hund lange genug triezt, dann zieht er beleidigt von dannen. Aber tut er das wirklich, weil er beleidigt ist? Oder interpretieren wir sein Desinteresse lediglich als Beleidigung? Bei Hunden und Katzen ist wohl am ehesten ein Konsens darüber herzustellen, dass man sie beleidigen kann. Aber was ist mit Hamstern? Mit Wühlmäusen? Oder mit Fischen?
| Erscheint lt. Verlag | 12.1.2009 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Heyne Bücher |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Die Kunst der Beleidigung |
| Maße | 118 x 187 mm |
| Gewicht | 213 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Lebenshilfe / Lebensführung |
| Schlagworte | Beleidigung • Menschliche Beziehungen • Zwischenmenschliche Beziehung |
| ISBN-10 | 3-453-60099-1 / 3453600991 |
| ISBN-13 | 978-3-453-60099-7 / 9783453600997 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich