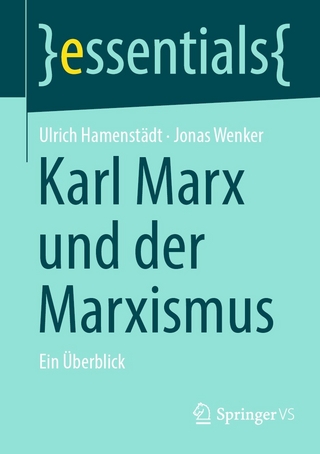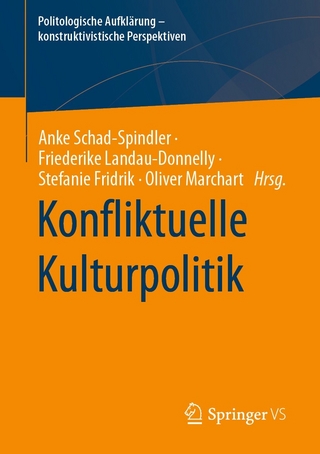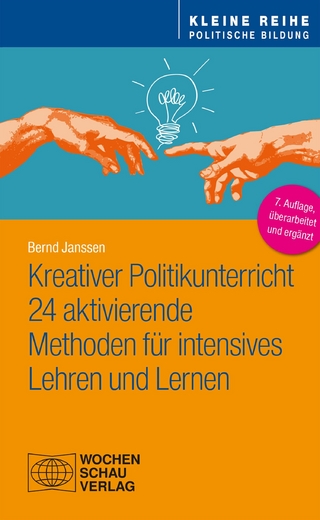Forschungsdesign in der Politikwissenschaft (eBook)
347 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-41400-3 (ISBN)
Thomas Gschwend ist Professor für Quantitative sozialwissenschaftliche Methoden an der Graduate School of Economic and Social Sciences, Universität Mannheim. Frank Schimmelfennig ist Professor für Europäische Politik an der ETH Zürich.
Thomas Gschwend ist Professor für Quantitative sozialwissenschaftliche Methoden an der Graduate School of Economic and Social Sciences, Universität Mannheim. Frank Schimmelfennig ist Professor für Europäische Politik an der ETH Zürich.
Vorwort
Einleitung
Forschungsdesign in der Politikwissenschaft: Ein Dialog
zwischen Theorie und Daten
Thomas Gschwend und Frank Schimmelfennig
Forschungsproblem
Na Und? Überlegungen zur theoretischen und gesellschaftlichen
Relevanz in der Politikwissenschaft
Matthias Lehnert, Bernhard Miller und Arndt Wonka
Konzepte und Theorie
Um was geht es? Konzeptspezifikation in der politikwissenschaftlichen Forschung
Arndt Wonka
Sinn und Unsinn von Typologien
Matthias Lehnert
Messung
Maßvoll Messen: Zur konzeptorientierten Entwicklung von
Messinstrumenten
Bernhard Miller
Identisch und doch verschieden, verschieden und doch vergleichbar?
Zur Äquivalenz von Sekundärdaten
Julia Rathke
Fallauswahl
Zum Umgang mit Selektionsverzerrungen in Forschungsdesigns
mit großer Fallzahl
Janina Thiem
Fallauswahl in der qualitativen Sozialforschung
Dirk Leuffen
Die mittlere Sprosse der Leiter: Fallauswahl in Forschungsdesigns
mit kleiner Fallzahl
Christoph Hönnige
Kontrolle alternativer Erklärungen
"Aber könnte es nicht auch sein dass…?": Die Auswahl unabhängiger
Variablen in X-zentrierten und Y-zentrierten Forschungsdesigns
Ulrich Sieberer
Einige Anregungen zur Auswahl zwischen konkurrierenden
Erklärungsansätzen in Y-zentrierter Forschung
Andreas Dür
Theoretische Schlussfolgerungen
Über Falsifikation in theoriegeleiteter empirischer Sozialforschung:
Wie man während der Fahrt den Reifen wechselt
Dirk De Bièvre
Lehren für den Dialog zwischen Theorie und Daten
Thomas Gschwend und Frank Schimmelfennig
Autorinnen und Autoren
Stichwortverzeichnis
Einleitung Ziel von Politikwissenschaftlern ist es, aus ihren empirischen Beobachtungen generelle Aussagen abzuleiten. Zu diesem Zweck ziehen wir kausale und deskriptive Rückschlüsse aus empirischen Beobachtungen. Ziel dieser Rückschlüsse ist es, zuverlässige deskriptive Informationen zu gewinnen, Theorien zu testen oder neue Theorien zu formulieren (King u.a. 1994). Die Validität empirischer und kausaler Rückschlüsse hängt grundlegend von klar spezifizierten Konzepten ab. Zunächst erlaubt die klare Definition unserer Konzepte anderen zu verstehen, wovon wir reden und schreiben. Darüber hinaus legt der Inhalt unserer Konzepte sowohl den explanativen als auch den empirischen Geltungsbereich unserer theoretischen Hypothesen fest. In weiteren Schritten des Forschungsprozesses spielen klar spezifizierte Konzepte vor allem bei der Formulierung der empirischen Forschungsstrategie und der daran anschließenden Entwicklung eines adäquaten Messinstrumentes eine zentrale Rolle (zur Diskussion von Messung siehe Miller in diesem Band). Der Grund hierfür ist offensichtlich: Wie sollen wir die Qualität und Angemessenheit eines Maßes beurteilen, wenn wir zuvor nicht klar bestimmt haben, was wir messen wollen? Eine Reihe von Aufsätzen und Buchkapiteln haben sich bereits theoretisch mit Konzepten und der Konzeptspezifikation auseinandergesetzt (Sartori 1970; 1984; Collier/Mahon 1993; Gerring 2001). In diesem Kapitel verfolge ich ein wesentlich bescheideneres, instrumentelles Ziel: Zunächst wird die Aufmerksamkeit des Lesers auf die zentrale Rolle von Konzepten in der politikwissenschaftlichen Forschung gelenkt. Zu diesem Zweck diskutiere ich, welchen Einfluss die Qualität von Konzepten auf die klare Verständlichkeit theoretischer Argumente sowie die Bestimmbarkeit des empirischen Geltungsbereiches einer Theorie hat. Wie in den anderen Kapiteln dieses Bandes stellt auch der dritte Abschnitt dieses Kapitels praktische Hinweise zur Verfügung, die helfen sollen, bei der Durchführung eigener Forschungsprojekte mit möglichst klaren Konzepten zu arbeiten. Der vierte Abschnitt wendet die praktischen Hinweise auf das Konzept der 'Supranationalität' an, mit dem ich mich selbst im Rahmen meiner eigenen Forschung auseinandersetze. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Diskussion. Designproblem: Konzepte und Konzeptspezifikation in der politikwissenschaftlichen Forschung Drei Elemente, die gemeinsam ein Konzept bilden, sind analytisch zu unterscheiden (Gerring 2001; Sartori 1984): Ein Terminus gibt dem jeweiligen Konzept einen Namen. Attribute, die den Inhalt und die Bedeutung des Konzeptes definieren, füllen den Terminus mit Substanz. Alle Attribute zusammengenommen bilden die Intension eines Konzeptes. Die Intension eines Konzeptes ist nicht nur deshalb wichtig, weil sie die inhaltliche Bedeutung eines Konzeptes definiert. Sie grenzt dieses gleichzeitig von anderen Konzepten ab. Starke Überschneidungen in der Intension unterschiedlicher Konzepte führen zu Abgrenzungsproblemen und provozieren inhaltliche Missverständnisse. Schließlich stellen die definierenden Attribute eines Konzeptes den Bezug zwischen dem Konzept und der empirisch beobachtbaren Welt her. Der empirische Geltungsbereich eines Konzeptes wird häufig als dessen Extension bezeichnet. Analytisch nützliche Konzepte ziehen klare Grenzen zwischen denjenigen empirischen Objekten, die sie selbst bezeichnen und denen, die von anderen Konzepten erfasst werden. Abbildung 1 fasst das hier Gesagte grafisch zusammen und stellt es in den weiteren Zusammenhang des 'Designs' eines Forschungsprojektes: Wir beginnen mit einer theoretischen Aussage, das heißt einer Hypothese (vergleiche hierzu die Kapitel von DeBièvre und Dür in diesem Band). Um sicher zu gehen, dass die inhaltliche Bedeutung der Aussage klar verständlich ist, spezifizieren wir die für die theoretische Aussage verwendeten Konzepte, indem wir deren definierende Attribute explizieren. Schließlich erfolgt die Operationalisierung der Konzepte, die erlaubt, diese systematisch zu empirisch beobachtbaren Phänomenen in Bezug zu setzen (Miller in diesem Band) - und damit die empirische Plausibilität unserer theoretischen Aussagen zu testen.
| Erscheint lt. Verlag | 8.10.2007 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialforschung |
| Co-Autor | Dirk De Bièvre, Andreas Dür, Christoph Hönnige, Matthias Lehnert, Dirk Leuffen, Bernhard Miller, Julia Rathke, Ulrich Sieberer, Janina Thiem, Arndt Wonka |
| Zusatzinfo | 12 s/w Abbildungen |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Gewicht | 476 g |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Forschungsdesign • Qualitative Studien • Quantitative Studien • Vergleichende Politikwissenschaft |
| ISBN-10 | 3-593-41400-7 / 3593414007 |
| ISBN-13 | 978-3-593-41400-3 / 9783593414003 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich