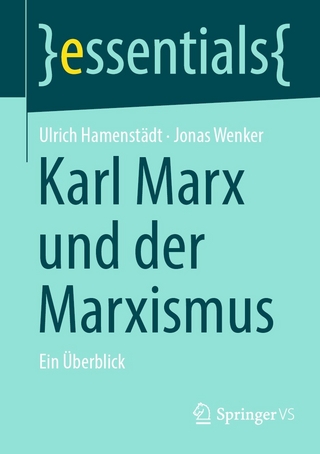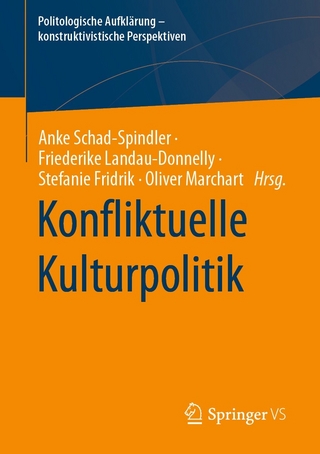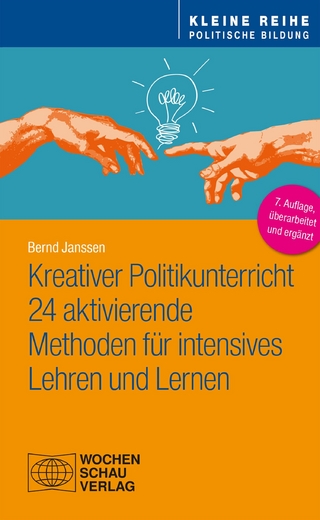Die Sakralität der Person (eBook)
303 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-75450-4 (ISBN)
<p>Hans Joas, geboren 1948, ist Ernst-Troeltsch-Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Professor für Soziologie an der Universität Chicago. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Hans-Kilian-Preis, dem Max-Planck-Forschungspreis, dem Prix Ricoeur und zuletzt mit dem Theologischen Preis der Salzburger Hochschulwochen.</p>
Einleitung
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Geschichte der Menschenrechte und der Frage ihrer Begründung. Es liefert aber weder eine umfassende Ideen- oder Rechtsgeschichte noch eine neue philosophische Begründung der Idee universaler Menschenwürde und der auf dieser Idee basierenden Menschenrechte. Beiden möglichen Erwartungen wird hier nicht entsprochen werden, und dies nicht aus eher trivialen Gründen wie denen, daß für eine umfassende Geschichte der Menschenrechte trotz aller imponierenden Vorarbeiten noch weitere umfangreiche Forschung nötig sei oder daß eine der vorliegenden philosophischen Begründungen, etwa von Kant oder Rawls oder Habermas, jeden neuen Versuch überflüssig gemacht habe. Charakteristisch für den hier eingeschlagenen Weg ist nämlich eine spezifische Weise der Verknüpfung von Begründungsargumenten und historischer Reflexion, die sich so in den Geschichten der Menschenrechte oder in den philosophischen Ansätzen nicht findet und dort in der Regel auch gar nicht angestrebt wird. Die ehrgeizigen philosophischen Begründungsversuche kommen ohne Geschichte aus. Sie konstruieren ihre Argumente aus dem (angeblichen) Charakter der praktischen Vernunft und des moralischen Sollens, den Bedingungen eines Gedankenexperiments über die Einrichtung von Gemeinwesen oder den Grundzügen eines idealisierten Diskurses heraus. Zur Geschichte stehen solche Konstruktionen notwendig in einem merkwürdigen Spannungsverhältnis. Merkwürdig muß ja aus dieser Perspektive erscheinen, daß in der Geschichte der Menschheit zeitlos Gültiges nur so selten als solches erkannt wurde. Ideengeschichte wird damit zur bloßen Hinführung zur eigentlichen Entdeckung, zur Vorgeschichte tastender und unvollkommener Versuche; Realgeschichte wird zu einem bloßen Auf und Ab der Annäherungen und Entfernungen vom Ideal, sofern nicht ein Fortschrittsmodell eine schrittweise Annäherung in der Vergan genheit und eine weitere Verwirklichung in der Zukunft zu denken erlaubt.
Die Geschichtsschreibung wiederum wird zwar häufig, bewußt oder unbewußt, von Vorstellungen über philosophische Begründung durchsetzt sein; sie kann auch eine Geschichte all der verschiedenen philosophischen, politischen und religiösen Argumentationen und Debatten über Menschenrechte und Menschenwürde enthalten. Als Wissenschaft muß sie aber ihren Anspruch auf die empirische Ebene einer sachgemäßen Rekonstruktion historischer Prozesse begrenzen. In ihrer Arbeitsteilung bekräftigen Geschichtswissenschaft und Philosophie damit die Unterscheidung von Genesis und Geltung, die von vielen für eine Grundlage jeder redlichen Beschäftigung mit normativen Fragen gehalten wird. Entweder, so diese Denkweise, steht der Geltungsanspruch normativer Sätze zur Diskussion, oder wir interessieren uns für ihre geschichtliche Herkunft. Zur Entscheidung über den normativen Geltungsanspruch kann in dieser Perspektive geschichtliches Wissen nichts, jedenfalls nichts Ausschlaggebendes beitragen.
Ich versuche in diesem Buch eine prinzipiell hiervon verschiedene Vorgehensweise; vielleicht ist die historisch orientierte Soziologie, auf die ich dabei immer wieder zurückgreifen werde, ein geeignetes Mittel, die beschriebene Kluft zwischen Philosophie einerseits und Geschichte andererseits zu überwinden. Der Grund für diese andere Vorgehensweise läßt sich zunächst negativ bezeichnen: Ich glaube nicht an die Möglichkeit einer rein rationalen Begründung letzter Werte. Schon die Formulierung der Aufgabenstellung erscheint mir als selbstwidersprüchlich. Wenn es sich wirklich um letzte Werte handeln soll, worauf kann dann eine rationale Begründung noch zurückgreifen? Was soll tiefer liegen als diese letzten Werte und doch selbst werthaften Charakters sein? Oder sollen letzte Werte gar aus Tatsachen abgeleitet werden? Selbstverständlich kann mit diesen Fragen nur ganz grob meine Skepsis gegenüber den philosophischen Begründungsversuchen plausibilisiert werden; diese Formulierungen erheben nicht den Anspruch, an dieser Stelle den großartigen Denkgebäuden gerecht zu werden, die zum Zwecke der rationalen Begründung universalistischer Moral errichtet wurden. Doch werden auch diejenigen, denen die Skepsis einleuchtet, die ich hier eingestanden habe, vielleicht vor den Konsequenzen zurückschrecken, weil sie annehmen, daß der Verzicht auf rationale Letztbegründung einem historischen oder kulturellen Relativismus oder der (angeblich) postmodernen Beliebigkeit Tür und Tor öffnet. Bei den Menschenrechten und der universalen Menschenwürde handelt es sich aber um einen so sensiblen Punkt, daß ein achselzuckendes oder spielerisches Verhältnis dazu wohl kaum in Frage kommt. Zwingt uns der Abschied von der rationalen Letztbegründung aber wirklich zum Relativismus? Dieser Sorge liegt eben das Denkschema der klaren Trennbarkeit von Genesis und Geltung weiterhin zugrunde. Aber gerade um dessen tätige Infragestellung geht es hier. Wenn im Fall der Werte Fragen von Genesis und Geltung nicht so scharf zu trennen sind, dann läßt sich auch positiv formulieren, worum es hier geht. Dann kann nämlich die Geschichte der Entstehung und Ausbreitung von Werten selbst so angelegt werden, daß sich in ihr Erzählung und Begründung in spezifischer Weise verschränken. Als Erzählung macht uns eine solche Darstellung bewußt, daß unsere Bindung an Werte und unsere Vorstellung vom Wertvollen aus Erfahrungen und ihrer Verarbeitung hervorgehen; sie sind damit als kontingent, das heißt nicht notwendig, erkennbar. Nicht länger erscheinen Werte dann als etwas Vorgegebenes, das nur zu entdecken oder vielleicht wiederherzustellen ist. Aber eine solche Erzählung muß keineswegs, indem sie uns die Tatsache bewußtmacht, daß unsere Werte historische Individualitäten sind, unsere Bindung an diese Werte schwächen und zersetzen. Anders als Nietzsche nehme ich nicht an, daß die Aufdeckung der Entstehung der Werte es uns wie Schuppen von den Augen fallen läßt, an welche bloßen Götzen und Idole wir bisher geglaubt haben. Wenn wir mit Nietzsche der Verschränkung von Genesis und Geltung in einer »Genealogie« gerecht werden wollen, dann kann dies durchaus eine affirmative Genealogie und muß nicht eine auflösende Entstehungsgeschichte sein.
Es geht also in diesem Buch um eine affirmative Genealogie des Universalismus der Werte. Da gegen ein solches Projekt bei jedem Schritt Einwände in der Luft liegen, wird in der Mitte des Buches (Kapitel 4) in einer methodischen Zwischenbetrachtung mehr zur Rechtfertigung des gewählten Wegs gesagt werden. Es muß ja erklärt werden, daß es universalistische Werte gibt, was eine Genealogie im allgemeinen und eine affirmative Genealogie im besonderen ist, und vieles andere mehr. An dieser Stelle ist zunächst nur festzuhalten, daß der Begriff »Entstehung der Werte« aus einem früheren Buch, an das das vorliegende als historisch-konkretisierende »Anwendung« anknüpft, sich gleich weit entfernt hält von den Begriffen »Konstruktion« und »Entdeckung«. Während der Begriff der Entdeckung es nahelegt, von einem präexistenten Reich der Werte oder einem objektiv gegebenen Naturrecht auszugehen, klingt »Konstruktion« nach einer willentlichen Erzeugung, von der dann schwerlich Bindungswirkungen ausgehen können; es könnten jedenfalls nur Bindungen einer selbstgewählten Art sein. Der Begriff der Entstehung zielt dagegen darauf, die echte historische Innovation, die etwa die Menschenrechte darstellen, als Innovation kenntlich zu machen und dabei gleichzeitig den Evidenzcharakter zu bewahren, den eine solche Innovation für die Beteiligten auch aufweisen kann. Für die Menschen, die sich an Werte gebunden fühlen, stellen diese Werte ganz offensichtlich das Gute dar, und dies nicht, weil sie das so beschlossen oder sich darauf geeinigt haben. Auch die Metapher der Geburt könnte angemessen sein, um auszudrücken, wie ein historisch neu gesetzter Beginn Unbedingtheit annehmen kann. In diesem Sinne also geht es hier um die »Geburt«, die »Entstehung« eines zentralen Komplexes universalistischer Werte und seine rechtliche Kodifizierung.
Die Entstehung gerade dieses Wertkomplexes ist spätestens seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts immer wieder Gegenstand hitziger Meinungskämpfe geworden. Eine der häufigsten, aber auch unfruchtbarsten Debatten dreht sich dabei um die Frage, ob die Menschenrechte eher auf religiöse oder auf säkular-humanistische Ursprünge zurückzuführen sind. Eine konventionelle Ansicht nicht so sehr in der Forschung, aber in der breiteren Öffentlichkeit, nimmt an, daß die Menschenrechte aus dem Geiste der Französischen Revolution hervorgegangen seien, dieser wiederum der politische Ausdruck der französischen Aufklärung sei, welche zumindest antiklerikal, wenn nicht offen antichristlich oder religionsfeindlich war. In dieser Sichtweise sind die Menschenrechte eindeutig nicht die Frucht irgendeiner religiösen Tradition, sondern vielmehr die Manifestation eines Widerstands gegen das Machtbündnis von Staat und (katholischer) Kirche oder gegen das Christentum als Ganzes.
Zwischen dieser konventionellen Sicht und einem säkularen Humanismus gibt es eine Art Wahlverwandtschaft ebenso...
| Erscheint lt. Verlag | 15.10.2011 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Menschenrechte • Person • Persönlichkeitsrechte |
| ISBN-10 | 3-518-75450-5 / 3518754505 |
| ISBN-13 | 978-3-518-75450-4 / 9783518754504 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich