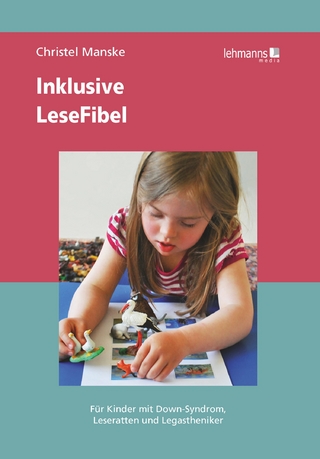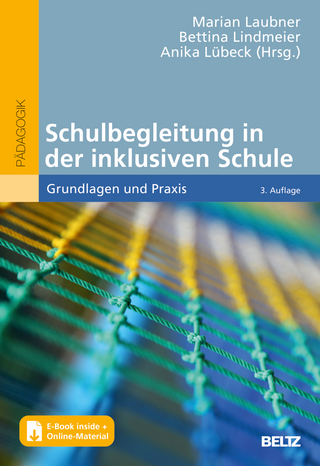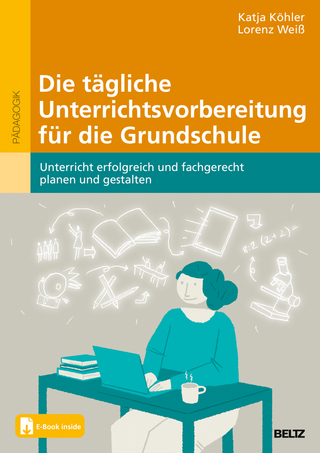"Das Böse" im Religionsunterricht: Mit Kindern und Jugendlichen theologisch reden über Tod, Leid und Theodizee
Diplomica Verlag
978-3-95850-899-6 (ISBN)
Die meisten Erwachsenen haben im Laufe ihres Lebens Strategien entwickelt, um mit dem sie betreffenden Negativen umzugehen. Kinder und Jugendliche aber sind erst noch dabei ihre Umwelt richtig einschätzen und ihre Lebenseinstellungen definieren zu lernen.
In jeder Lern- und Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen begegnen uns entsprechende Fragen. Wieso gibt es Ungerechtigkeit? Warum tut niemand etwas dagegen? Woher haben die Menschen den Willen, Böses zu tun und wer sollte sie daran hindern? Kinder stellen diese Fragen, für die wir Erwachsenen keine eindeutigen Antworten haben und sind - verständlicherweise - mit dem Ergebnis oft unzufrieden. Dabei sind viele Antworten bereits vorhanden und zwar in den Kindern selbst. Man muss nur den richtigen Weg finden, sie herauszubekommen.
Textprobe:
Kapitel 3, Gott und das Leid Didaktische Aspekte:
3.1, Entwicklungspsychologische Grundlagen und Modelle:
Nachdem nun eingehend versucht wurde zu erklären was das Leid denn nun eigentlich sei, muss nun im Mittelpunkt stehen, wie Kinder und Jugendliche überhaupt Leid wahrnehmen und selber leiden. Dabei will ich darauf eingehen, wie Kinder verschiedener Altersgruppen trauern bzw. Verlust hinnehmen, was sie als gerecht empfinden, und welche Rolle dabei das Gottesverständnis einnimmt. Im Anschluss werde ich anhand verschiedener früherer Untersuchungen ergründen, ob und in welchem Maße die Theodizeefrage für Kinder und Jugendliche heute noch von Bedeutung ist. Im letzten Punkt möchte ich aus schulischer Sicht darauf eingehen, welche Kompetenzen aufseiten der Schüler gefördert werden können und müssen, und welche relevante Bedeutung sich daraus für den Unterricht und das verwendete Material ergibt.
Dass Kinder trauern, daran gibt es keinen Zweifel. Nur ist manchmal die kindliche Trauer für Erwachsene schwer nachzuvollziehen, zu verstehen und zu deuten. Matthias Günther gibt in seinem Buch Eltern und Erziehern Hilfestellung, wenn es darum geht den kindlichen Trauerprozess einzuschätzen. Für die Schulzeit von Bedeutung sind dabei die Stufen der Kindheit, Frühadoleszenz und Adoleszenz. Und obwohl man bei solchen verallgemeinernden Übersichten immer den individuellen Entwicklungsstand des Schülers berücksichtigen muss, so finden wir darin doch einen ersten Eindruck und Leitfaden.
Kindheit (6-12 Jahre). Ab der Schulzeit verstehen die Kinder mehr und mehr die Erfahrung des endgültigen Verlustes beim Tod eines Menschen. Verstorbene sind nicht am nächsten Tag wieder lebendig, sie sind nicht verreist oder irgendwie tot . Das Verständnis für die Unausweichlichkeit des Todes wächst, und damit auch der Gedanke, dass man selbst sterben muss hier liegt die Herausforderung der Altersstufe. In diesem Alter haben viele Kinder bereits Vorerfahrungen mit Verlust und Abschied, sei es durch den tatsächlichen Tod eines Haustieres oder der Großeltern, oder durch den Verlust eines geliebten Gegenstandes (Kuscheldecke, Schnuller etc.), Ortes (durch Um- und Wegzug) oder lieben Freundes. Die beste Hilfe bei trauernden Kinder kann es sein, sachlich-nüchterne Informationen zum Sterben zu sammeln und den Abschied mitzugestalten: das gibt dem Kind das Gefühl, Kontrolle wiederzugewinnen, die es durch den Tod verloren zu haben glaubte. Letztendlich wird dadurch der Verlust akzeptiert. Das heißt nicht, dass der Verstorbene aus der Gedanken- und Gefühlswelt des Kindes verschwindet, sondern vielmehr, dass er auch weiterhin in begrenzter Form am Leben des Trauernden teilhat (zum Beispiel: Mama passt jetzt vom Himmel aus auf mich auf. ).
Frühadoleszenz (12-16 Jahre). In den Klassen der höheren Schulformen finden wir bereits verstärkt ein ausgereiftes gedankliches Konstrukt vom Tod (vgl. 2.1.3). Bestehende Ängste den Tod betreffend werden aber oft verdrängt oder verleugnet, und eine offene Auseinandersetzung mit der (eigenen) Sterblichkeit wird oft abgelehnt. Die Herausforderung dieser Altersstufe liegt in der parallel stattfindenden Entwicklung eines neuen Person-Umwelt-Verhältnisses. Der Jugendliche löst sich aus den alten Bezugssystemen, wie der Familie oder Gemeinde und wendet sich verstärkt seinen Peers oder bereits ersten Beziehungspartnern zu. Der Rückhalt innerhalb der neuen Bezugssysteme kann in Konfliktsituationen aber noch unzureichend sein, während die Hilfe aus den alten Personengruppen bewusst abgelehnt wird, sodass bei Trauer auf noch nicht stark entwickelte eigene Strategien zur Bewältigung zurückgegriffen werden muss.
Adoleszenz (16-18 Jahre). Mit dem wachsenden Gefühl von Verantwortung für das eigene Leben und das anderer steigt in Konfliktsituationen auch die Chance, dass sich Schuld- und Ohnmachtsgefühle entwickeln. Der junge Erwachsene gesteht sich die Möglichkeit ein, gegen Unrecht un
| Erscheint lt. Verlag | 20.3.2015 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 155 x 220 mm |
| Gewicht | 154 g |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Schulpädagogik / Grundschule |
| Schlagworte | Religionsunterricht • Theodizee |
| ISBN-10 | 3-95850-899-5 / 3958508995 |
| ISBN-13 | 978-3-95850-899-6 / 9783958508996 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich