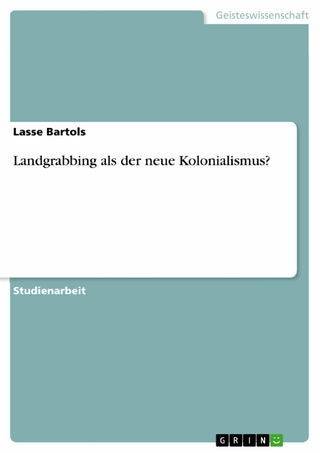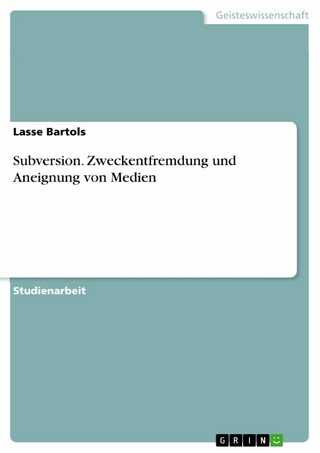Leben in Kooperation (eBook)
286 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-43261-8 (ISBN)
Matthias Möller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiengang Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg.
Matthias Möller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiengang Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg.
Inhalt 6
Einleitung: Eine »cooperative Rarität Europas« 12
1 Zugänge, Perspektiven und Problemstellungen 18
1.1 Gemeingüter, Gemeinwirtschaft, Genossenschaften 18
1.2 Arbeiterbewegungs- und Arbeiteralltagskultur im Wandel 22
1.2.1 Kultureller und ökonomischer Dualismus 22
1.2.2 Genossenschaften und Arbeiterbewegung 24
1.2.3 Vorfeld oder Säule? 26
1.2.4 Kulturanthropologische Arbeiterforschung 29
1.2.5 Arbeit, Freizeit, Reproduktion 35
1.3 Die Konstruktion von Gemeinschaften 40
1.4 Das Freidorf – eine Reformsiedlung im Wandel 42
1.4.1 Forschungsstand 42
1.4.2 Fragestellung und methodisches Vorgehen 43
1.4.3 Quellen 46
2 Genossenschaftliche Bewegung im Wohnbereich im 19. und frühen 20. Jahrhundert 50
2.1 Von der Wohnungsfrage zur Eigentumsfrage 50
2.2 Städtische Spar- und Bauvereine 52
2.3 Ländliche Siedlungsgenossenschaften 54
2.4 Weiterentwicklungen: Wohnen als Reformprogramm 55
2.5 Aufschwung und Ausdifferenzierung der Wohngenossenschaften 57
3 Ein neues Dorf für freie Menschen 62
3.1 Konsumgenossenschaftsbewegung in der Schweiz 62
3.2 Sozialreformer vor neuen Aufgaben 64
3.3 Krise und soziale Polarisierung um 1918 67
3.4 Der VSK stiftet eine »Heimstätte der Nächstenliebe, des Friedens und der Freiheit« 69
3.5 Das Architekturkonzept: ein Dreieck aus konzentrischen Kreisen 70
3.6 Regeln für die neue Gemeinschaft 79
3.7 Das genossenschaftliche Programm: die Organisation derWohnstube als dritter Weg 82
4 Die ersten 25 Jahre der Siedelungsgenossenschaft Freidorf 87
4.1 Genossenschaftliche Selbstverwaltung in der Praxis 90
4.1.1 Geselliges und Grundsätzliches: die Generalversammlung 90
4.1.2 Koordination und Geschäftsführung: der Verwaltungsrat 91
4.1.3 Bereichsbezogene Basisgruppen: die Kommissionen 93
4.2 Siedlungsbezogene Arbeiten und Aktivitäten 97
4.2.1 Konsum und Versorgung 98
4.2.2 Absicherung und Vorsorge 101
4.2.3 (Aus-)Bildung und Erziehung 104
4.2.4 Bewirtung und Geselligkeit 109
4.2.5 Engagement von und in Vereinen 110
4.2.6 Feste und Feiern 114
4.3 Alltagskultur in der Gemeinwirtschaft 118
4.3.1 Hausarbeit und Familienorganisation in der Frühphase des Freidorfs 119
4.3.2 Kooperation und ihre Grenzen 122
4.3.3 Wohnen zwischen privaten und kollektiven Ansprüchen 127
4.4 Das Freidorf Mitte der 1940er-Jahre 131
4.4.1 Die weltanschauliche Verortung 133
4.4.2 Leben und Arbeiten in der Siedlung 135
4.4.3 Genossenschaftliche Ökonomie 137
4.5 Jubiläumsfeier 1944 und Zukunftsprognose 141
5 Ökonomischer, sozialer und alltagskultureller Wandel nach 1945 144
5.1 Fordismus in der Schweiz 145
5.2 Muttenz und Basel auf dem Weg zur Agglomeration 149
5.3 Der VSK im Wirtschaftsaufschwung 151
5.4 Haushaltsführung im Hochfordismus 154
6 Das Freidorf zwischen 1945 und 1969 160
6.1 Ergänzende Zugänge 160
6.1.1 Interviews 160
6.1.2 Historische Demografie 162
6.2 Die Siedlerschaft der SGF 162
6.2.1 Demografische Entwicklung 162
6.2.2 Polarisierende Konflikte 165
6.3 Reproduktion im Wandel 171
6.4 Einrichtungen und Betriebe vor neuen Herausforderungen 180
6.4.1 Abgewanderte Kundschaft: Seminarbetrieb und Restaurant 180
6.4.2 Neue NutzerInnen: Bibliothek und Schule 181
6.4.3 Sparen und Versichern als stabiles Mitgliedergeschäft 183
6.4.4 Von der Warenabgabestelle zum Supermarkt 185
6.5 Selbstverwaltung, Arbeit, Engagement 191
6.5.1 Kommissionen ohne neue Mitglieder und Tätigkeiten 191
6.5.2 Geschäftsführung unter Professionalisierungsdruck 198
6.5.3 Unumstrittene Maßnahmen: die Generalversammlungen 200
6.6 Wirtschaftliche Probleme und die Zukunft des Genossenschaftshauses 202
6.7 Binnensichten auf das Freidorf 207
7 Das Siedlungsexperiment Freidorf: Traditionen und Transitionen 212
7.1 Die genossenschaftliche Gemeinschaftskonzeptiondes Freidorfes 212
7.2 Gemeinschaftskonstruktion in der Zwischenkriegszeit 213
7.3 Fragmentierte und aktualisierte Vergemeinschaftungen 219
7.3.1 Historisierende Rückblicke 220
7.3.2 Das Jubiläum von 1969 222
7.4 Die Erosion der alten Siedlungsgemeinschaft 227
7.4.1 Raum, Geschlecht, Generation 227
7.4.2 Entwicklungslinien 234
8 Freidorf-Erfahrung und heutige Wohnkooperativen 239
Literatur und Quellen 246
Berufe der Haushaltsvorstände des Freidorfs 1922–19691 278
Abkürzungen 279
Bildnachweise 282
Dank 286
Einleitung: Eine 'cooperative Rarität Europas
'Seit 1920 bietet im Osten von Basel die Siedelung Freidorf dem Flieger wie dem Volksfreund ein gleicherweise rosig schimmerndes Peilziel. Dem Erdkundigen ein neuer Ort auf der Siegfriedkarte, dem Bourgeois rotes Nest, dem Sovjetstern nicht rot genug, dem Aestheten Kaserne, dem Gläubigen Stätte der Religionslosigkeit, dem Eigenbrödler Zwangserziehungsanstalt, dem Privathändler Todschlagsversuch an seiner Wirtschaftsform, und dem Genossenschafter die erste schweizerische Vollgenossenschaft und eine cooperative Rarität Europas: Das ist die Siedelungsgenossenschaft Freidorf.'
Die Siedelungsgenossenschaft Freidorf (SGF) wurde 1919 vom Verband schweizerischer Konsumvereine (VSK), dem Vorläufer der heutigen Coop-Gruppe, gegründet. In Zeiten wirtschaftlicher Not und sozialer Polarisierung errichtete sie zwischen Basel und Muttenz 150 Häuser für Familien der Konsumgenossenschaftsbewegung. Als weitläufige Gartenstadt mit Einfamilienhäusern setzte sich das Freidorf von den ärmlichen Wohnverhältnissen in städtischen Arbeiterquartieren ab und schuf für geringe Einkommen neue, damals unerreichbare Wohnverhältnisse. Das 8,5 Hektar große Ensemble gilt als bedeutendster Siedlungsbau der Zwischenkriegszeit in der Schweiz. Es genießt auch als Frühwerk des späteren Dessauer Bauhausdirektors Hannes Meyer (1889-1954) größere Aufmerksamkeit. Doch neben seiner baulichen Gestalt ist vor allem das mit ihm verbundene soziale Experiment von Interesse: Der VSK verfolgte mit dem Freidorf die modellhafte Implementierung eines dörflich-genossenschaftlichen Sozialismus. Das Siedlungsleben wurde auf kooperativer Grundlage organisiert, was nach den konsumgenossenschaftlichen Vorstellungen der Gründer von den Haushalten und deren Bedarfsdeckung ausging, darüber hinaus jedoch weitere Bereiche des Dorflebens einschloss. Im Freidorf sollten neue, genossenschaftliche Menschen herangezogen werden, um ein kooperatives Gemeinwesen vorzuleben und damit beispielhaft die Überlegenheit genossenschaftlicher Zusammenschlüsse über die kapitalistische Konkurrenzwirtschaft zu demonstrieren. Dafür stellte der VSK die beachtliche Summe von 7,5 Millionen Franken zur Verfügung, mit denen eine im Hinblick auf Ausstattung und Konzept herausragende Genossenschaftssiedlung entstand, die damals ihresgleichen suchte. So war das Freidorf bereits in den 1920er Jahren ein exponiertes Beispiel für genossenschaftliche Wohnreform und ein international beachteter Modellversuch. Auch später wurde es als 'Idealtyp einer Baugenossenschaft' beziehungsweise als eines 'der interessantesten Genossenschaftsexperimente der Welt' bezeichnet.
War die Freidorfsiedlung bereits in der Zwischenkriegszeit eine Besonderheit, so dürfte sie nach dem Krieg auf dem europäischen Festland nahezu einzigartig gewesen sein. Dafür trägt der Bruch durch den Nazifaschismus entscheidende Verantwortung, der gewerkschaftliche Wohnungsunternehmen und Genossenschaften beschlagnahmte, gleichschaltete und zentralisierte. So sollte der Zusammenhalt in den roten Siedlungen, ihre kooperative Wirtschaftsweise und politische Kultur grundlegend zerstört werden. Nach 1945 wirkten die Eingriffe weiter, so dass in der BRD keine vergleichbare Genossenschaftskultur mehr entstand. Bilanzierend stellt der Historiker Rüdiger Hachtmann fest, dass
'dezentrale, gewerkschaftsnahe Genossenschaften - die deren Protagonisten vor 1933 auch als zentrale Elemente einer friedlichen ?Sozialisierung von unten? verstanden hatten [...] dauerhaft nicht wieder erstanden. Fu?hrende Mitglieder des DGB und die leitenden Manager der den Gewerkschaften ru?ckerstatteten Unternehmen und Genossenschaften erlagen der Faszination großer o?konomischer Einheiten. Dass sie damit weiter einen Weg beschritten, den die Deutsche Arbeitsfront 1933 eingeschlagen hatte, war ihnen scheinbar das kleinere U?bel, als aufwendig eine Vielzahl von basisnahen, lokalen Einheiten wieder zu gru?nden.'
Mit dem Schweizer Freidorf hat dagegen eine herausragende sozialreformerische Siedlung die NS- und Kriegszeit ohne größere Eingriffe überstanden. Umso erstaunlicher ist das Fehlen einer sozialhistorischen Untersuchung seiner Entwicklung, zumal das Freidorf bereits zu Beginn der 1980er-Jahre als Modell einer Gegenökonomie von Klaus Novy (1944-1991) (wieder-)entdeckt worden war. Der Bauo?konom und Experte fu?r genossenschaftliches Wohnen war tief beeindruckt vom Freidorf, in dem er eine im Kleinen konkret gewordene, antikapitalistische Utopie sah. Er verwendete es als herausragendes Beispiel für Selbsthilfe und Selbstorganisation im Kontext einer Aneignungsbewegung der Zwischenkriegszeit, die er als positive Ökonomie der Arbeiterbewegung beziehungsweise als Wirtschaftsreformbewegung von unten bezeichnet. Die (von ihm nur knapp behandelte) Geschichte des Freidorfs sieht er als Anlass zur Reflexion solch basisbezogener, demokratischer Ansätze der Gegenökonomie, denn
'das ökonomisch und ästhetisch grandios angelegte Freidorf ist heute [1982] Ausdruck des Umschlages des Traumes von der großen Harmonie in schlichte Spießigkeit. Ähnliches gilt für fast alle Fälle aus dem Umfeld der historischen Arbeiterbewegung; die Miefigkeit des ?Dorfes? hat jedes Bemühen um Freisetzung von unnötigen Zwängen verdrängt. Jede soziale Dynamik und Phantasie scheint stillgestellt. Die einst mühsam erkämpften und erarbeiteten Kollektiveinrichtungen verfallen oder werden privatisiert.'
Für eine Reflexion der Transformationsprozesse sind jedoch 'Spießigkeit' und 'Miefigkeit' keine geeigneten Kategorien, vor allem da sie zugunsten einer vorwurfsvollen Grundhaltung die Frage vernachlässigen, was eigentlich in der Siedlung, ihren alltäglichen Prozessen und selbstverwalteten Strukturen geschah. Der Genossenschaftswissenschaftler Wilhelm Werner Engelhardt hat in diesem Zusammenhang Behutsamkeit angemahnt, um vorschnelle Anprangerungen vermeintlicher Degenerationen aus einem überzeitlichen, moralischen Standpunkt heraus zu vermeiden. Novy selbst warnte davor, das Scheitern genossenschaftlicher Reformprojekte einzig einer genossenschaftsfeindlichen Umgebung anzulasten. Dies umgehe die entscheidende Frage nach den 'immanenten Funktionsbedingungen nichtkapitalistischer Ökonomieformen. Darüber etwas zu erfahren, das müßte der kritische Rückgriff auf die Geschichte der ?vergessenen dritten Säule? der Arbeiterbewegung leisten.'
Das Freidorf existiert auch heute noch als Genossenschaft. Sein vielfältiger Quellenbestand ermöglicht eine höchst seltene Perspektive auf die Entwicklung genossenschaftlicher Reformsiedlungen: eine Längsschnittuntersuchung der internen Entwicklung über Jahrzehnte. Sie nimmt insbesondere die Arbeitsprozesse in der Siedlung in den Blick und untersucht die Strukturen, in denen die Arbeit an der kollektiven Reformidee organisiert wurde, die Voraussetzungen, auf denen sie aufbaute, und die siedlungsbezogenen Abläufe, die daraus folgten. Die dabei wirksamen Praktiken und Muster gilt es freizulegen, um mehr über interne Abläufe und Dynamiken zu erfahren. Novy nennt diesen Ansatz '?wirtschaftsarchäologische? Bemühungen zur Vielfalt verschütteter Formen der Gegenökonomie', die als 'historische Problemrekonstruktion [...] nicht nur die Genese dieser Aufbauwerke, sondern auch die Etappen ihres Scheiterns, die möglichen Fehlentscheidungen, verpaßten Weichenstellungen, offen gebliebenen Optionen aufarbeiten und in eine aktuelle Problemthematisierung einbringen' müsste. Für das Freidorf bedeutet dies eine Untersuchung der internen Siedlungsentwicklung hinsichtlich Engagement und Mitarbeit in genossenschaftlichen Strukturen, Nutzung der kollektiven Infrastruktur, Entwicklung reformerischer Ansätze und dem Alltag der dort lebenden Familien.
Seit den 1880er Jahren wurden in Deutschland Wohngenossenschaften gegründet, die sich auch als programmatische Alternative zur kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft verstanden. Sie entstanden im Kontext der Arbeiterbewegung und der sozial- und lebensreformerischen Strömungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Auch die wohngenossenschaftliche Gründungswelle nach 1918 fand hauptsächlich im Umfeld der Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen statt. Daher wird zunächst auf Forschungen zur Arbeiterkultur und ihren Transformationen unter Berücksichtigung genossenschaftlicher Ansätze eingegangen. Anschließend zeichne ich die Entstehung, Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung wohngenossenschaftlicher Ansätze des ausgehenden 19. Jahrhunderts nach, da hier direkte ideengeschichtliche und persönliche Verbindungslinien zur Freidorfgründung bestehen. Die SGF kann daher als idealtypische Verwirklichung einer spezifischen wohngenossenschaftlichen Richtung gesehen werden, die enge Verbindungen zu Konsumgenossenschaften aufweist. Nach der Gründungs- und Baugeschichte widme ich mich der Frühphase des Freidorfs und der Frage, wie das reformerische Programm umgesetzt und gelebt wurde. Neben der Darstellung, wie sich die SGF zwischen 1919 und 1969 entwickelte, wird aufgezeigt, wie sich sozialer und kultureller Wandel im gemeinwirtschaftlichen Selbsthilfemilieu der SGF niederschlug und was dies für den Alltag, die Arbeitsabläufe und die internen sozialen Beziehungen bedeutete. Diese Wechselbeziehungen zwischen häuslich-reproduktiver Arbeit, siedlungsbezogener Freizeit und der Arbeit in der und für die Siedlungsgenossenschaft gestatten tiefe Einblicke in die Organisationsformen von Arbeit und Alltag aus einer wohngenossenschaftlichen Perspektive. Den Endpunkt bildet die Entwicklung von einer sozialreformerischen, dem Anspruch nach alle Lebensbereiche umfassenden Vollgenossenschaft zu einer reinen Wohngenossenschaft. Sie wurde nach krisenhaften Jahren Ende der 1960er-Jahre auch programmatisch vollzogen. Hier interessieren wiederum vor allem Auswirkungen, Abläufe und interne Umgangsweisen mit sozialem und kulturellem Wandel. Die Geschichte des Freidorfs ist jedoch mehr als die Geschichte des Scheiterns genossenschaftlicher Utopien. In ihrem Entstehen, Gelingen und Vergehen steckt zugleich ein großer Erfahrungsschatz in Bezug auf kooperative Wohnformen. Das Nachzeichnen von Ereignissen, Auseinandersetzungen und Prozessen möchte daher nicht nur historisches Wissen zutage fördern, sondern zugleich Anregungen für heutige genossenschaftliche Wohnprojekte geben und der Frage nach Stabilitätskriterien von wohngenossenschaftlichen Initiativen nachgehen. Mit einer darauf ausgerichteten Aufbereitung der durch die Entwicklung des Freidorfs aufgeworfenen Fragen schließt diese Arbeit ab.
1 Zugänge, Perspektiven und Problemstellungen
1.1Gemeingüter, Gemeinwirtschaft, Genossenschaften
Kollektiv genutzte Güter stellen in einer von Privatbesitz und individueller Aneignung geprägten Umgebung eine faszinierende Herausforderung dar. Einerseits können sie alternative Möglichkeiten von Güterverwaltung und -verteilung aufzeigen, andererseits erweisen sie sich oft als fragil und ihr längerfristiger Bestand hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Zu äußeren Einflüssen, die häufig wenig beeinflussbar sind, tritt das Binnenverhältnis der beteiligten AkteurInnen und ihre Stellung zum gemeinsam verwalteten Gut. Zentral ist das Verhältnis von individuellen und kollektiven Interessen, von Vorstellungen und Zielen der Basis zu den Ansprüchen und Regeln des Kollektivs.
Lange stand dabei der Zustand eines stabilen Einklangs unter dem Verdacht, eine zwar erstrebenswerte, aber letztlich nicht erreichbare Utopie zu sein. Für den Biologen Garret Hardin (1915-2003) sind Spannungsverhältnisse zwischen Individuum und Gemeinschaft anfällig für die sogenannte Tragik der Allmende (Tragedy of the Commons). Sie besagt, dass persönliche Nutzenmaximierungen Überbeanspruchungen zur Folge haben, die schädliche Auswirkungen auf kollektiv genutzte Güter haben. So würden sich individuelle Kosten-Nutzen Entscheidungen 'zu einem irrationalen Dilemma für die Gruppe' addieren, die letztlich zum Scheitern der Nutzungsgemeinschaft führe.
Als allgemeines Erklärungsmodell fand die Tragik der Allmende weite Verbreitung und sorgte für grundsätzliche Skepsis gegenüber kollektiven Nutzungsformen. Demgegenüber betrachtet die Ökonomin Elinor Ostrom (1933-2012) Allmenden von ihrem Gelingen her. Ihr Thema sind die Bedingungen, die Nutzungsgruppen in die Lage versetzen, tragfähige Verwaltungs- und Zugangsregelungen zu entwickeln. Ostrom untersuchte über längere Zeiträume bestehende Allmenden natürlicher Ressourcen und arbeitete daraus Kriterien für deren dauerhaftes Fortbestehen heraus. Zentral sind demnach klar definierte und befolgte Nutzungsregeln, die auf lokale Bedingungen und Bedürfnisse abgestimmt sind. Hinzu tritt die Organisierung der Beteiligten und ihre Mitbestimmung am Reglement. Im Falle von Konflikten ist zudem der Zugang zu niederschwelligen Konfliktlösungsmechanismen entscheidend. Mit ihrer Forschung rückt Ostrom die Einbettung von Allmenden in soziale Beziehungen sowie die Herausbildung und (De?)Stabilisierung von Normen und Werten ins Zentrum und damit eine Perspektive, für die kulturanthropologische Zugänge und ethnografisch dichte Beschreibungen einen wichtigen Beitrag leisten können. Der Kulturwissenschaftler Dieter Kramer hat in diesem Zusammenhang auf Gemeingüter als Forschungsthema der Europäischen Ethnologie hingewiesen und die Bedeutung von Geselligkeit, Bräuchen und Festen als stabilisierende Muster von Vergemeinschaftungen betont, die bei historischen Gruppen wie aktuellen Praktiken von Gemeinschaftsarbeit bestehen. In historischer Perspektive verweist Kramer auch auf 'Erfahrungen der Arbeiterbewegung mit ihren Sozialkassen und Konsumgenossenschaften'.
Ausgehend von Ostrom hat sich eine breite Debatte um Allmenden und Gemeinnutzungen entwickelt, die im Zusammenhang mit Positionsbestimmungen steht, wie auf neoliberale Privatisierungen reagiert werden könnte, ohne defensiv an staatlichen oder kommunalen Trägerformen festzuhalten. Dabei wurde eine Begrenzung auf Naturressourcen schnell überwunden, was zu einer Ausweitung des ursprünglichen Gegenstandes führte. Unter dem Begriff Commons werden seither eine Vielzahl von Gütern diskutiert, für die eine kollektive Nutzung praktiziert wird oder möglich erscheint. Demnach sind Commons nicht auf bestimmte Versorgungsbereiche, sondern nur ideell eingrenzbar. Sie bestehen aus 'einer Ressource (die stofflich oder immateriell sein kann), den Menschen, die diese Ressource nutzen [...] und den [...] Aneignungsregeln. Commons [...] entstehen aus einer sozialen Praxis, die wir Commoning nennen, die gemeinsme Sorge um etwas, sei es ein Gemeinschaftsgarten, ein genossenschaftliches Unternehmen oder der freie Internetzugang'.
Neben Saatgut, Wissen, Software und anderem mehr wurde auch der Wunsch nach Wohnraumversorgung jenseits von (kapitalistischem) Markt und Staat Teil der Debatte, häufig unter Bezug auf bestehende Erfahrungen mit selbstorganisierten Mietshäusern in Gemeinschaftseigentum. Bereits in den frühen 1980er-Jahren hatte Klaus Novy diesen Typus von privatwirtschaftlicher und staatlicher Wohnraumversorgung unterschieden. Er zeichnet sich durch basisdemokratische Verwaltungsstrukturen aus, ohne dass die wechselnden NutzerInnen Eigentumsrechte wie Verkauf oder private Profite wahrnehmen können. Die Erträge kommen stattdessen dem Auf- beziehungsweise Ausbau weiterer selbstverwalteter Mietshäuser zugute und verbreitern damit die als Gemeingut genutzte Basis. In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der frei-gemeinwirtschaftlichen Unternehmen geläufig. Sie sind nicht in erster Linie profitorientiert und verfolgen soziale beziehungsweise am Allgemeinwohl orientierte Ziele freiwillig und ohne öffentlichen Auftrag.
Bei diesem Unternehmenstypus haben Genossenschaften, vor allem im historischen Rückblick, eine herausragende Bedeutung. Als deren allgemeine Wesensmerkmale gelten Mitgliederförderung, Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung und die Identität von EigentümerInnen und NutzerInnen. Im Binnenverhältnis agiert ein demokratisch organisierter Zusammenschluss gleichermaßen als Anbieter und Nutzer, so dass Angebots- und Nachfrageseite nicht getrennt auftreten. Daher ist der Einklang von subjektiven und kollektiven Interessen eine wichtige Voraussetzung für genossenschaftliche Organisierungen. Dies kann sich auf eine kooperative Unternehmensführung zur individuellen Nutzenmaximierung beschränken. Möglich ist jedoch auch, dass weitergehende ideelle Ziele zur Basis des genossenschaftlichen Zusammenschlusses gemacht werden, einheits-, solidaritäts- und identitätsstiftend wirken und politische Ziele verfolgen. So mobilisieren Genossenschaften Idealismus und Engagement oftmals im Kontext von breiteren sozialen, politischen oder kulturellen Bewegungen. Nach dem Historiker Michael Prinz ist es diese Einbindung in breitere Zusammenhänge, 'die den Hiatus zwischen Eigeninteresse und altruistischem Engagement u?berbru?ckt und zur Mobilisierung der außerallta?glichen Anstrengungen [...] unerla?sslich ist'.
Für eine Differenzierung des weiten Spektrums genossenschaftlicher Unternehmungen ist eine Unterscheidung anhand der Tätigkeitsfelder üblich, die zwischen Verbraucher-, Bau-, Bank-, Absatz- und Produktionsgenossenschaften unterscheidet. Wohngenossenschaften gelten hier als Teil der Verbrauchergenossenschaften, die nicht der Produktion, sondern der Versorgung mit Gütern oder Dienstleistungen dienen. Damit besteht zwischen Wohn- und Konsumgenossenschaften eine theoretische Verwandtschaft. Quer zu solchen Einteilungen liegt die Frage, ob es sich um Genossenschaften im engeren, juristischen oder weiteren soziologischen Sinne handelt. Letztere umfassen nicht nur Organisationen in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft, sondern auch andere kooperative Zusammenschlüsse. Ebenfalls möglich ist eine Unterscheidung anhand des genossenschaftlichen Zwecks. Genossenschaften können sowohl der individuellen Besserstellung ihrer Mitglieder als auch weitergehenden kollektiven bis gesellschaftsreformerischen Zielen dienen. Eine solche Differenzierung orientiert sich daran, in welchem Maße Überschüsse individuell ausgeschüttet werden, im Kollektiv verbleiben oder gruppenexternen Zielen dienen. Eine Betonung des ersten Aspekts kennzeichnet die mittelständischen Genossenschaften nach dem Vorbild von Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883). Demgegenüber wurden in der sozialistischen Genossenschaftsbewegung auch weitergehende, gesellschaftsreformerische Ziele verfolgt, was sich insbesondere bei den Produktiv- und Konsumgenossenschaften, aber auch bei Wohngenossenschaften zeigte. Sozialreformerische, der Arbeiterbewegung nahestehende Genossenschaften können daher als eigenständige Richtung innerhalb des genossenschaftlichen Spektrums gelten, die sich weiter ausdifferenzierte.
| Erscheint lt. Verlag | 8.10.2015 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Arbeit und Alltag |
| Zusatzinfo | 20 Abbildungen in s/w |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Ethnologie |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Genossenschaft • Kapitalismus • Lebensreform • Modellsiedlung • Schweiz • Siedlungsreform • Sozialismus • Wohngenossenschaft |
| ISBN-10 | 3-593-43261-7 / 3593432617 |
| ISBN-13 | 978-3-593-43261-8 / 9783593432618 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich