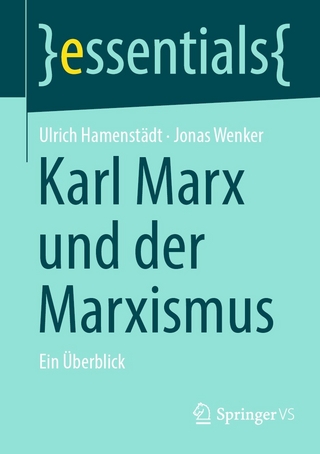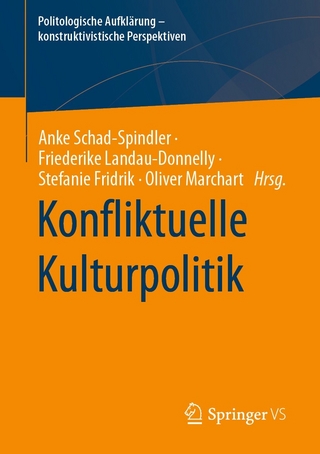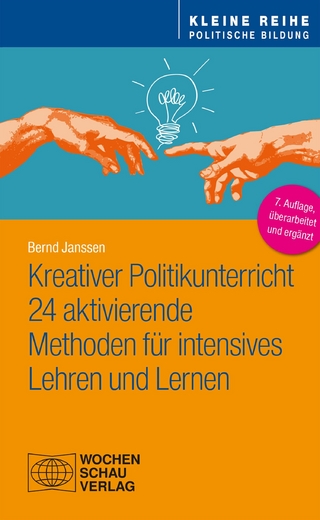Affekt und Revolution (eBook)
216 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-43336-3 (ISBN)
Judith Mohrmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung (IfS), Frankfurt am Main.
Judith Mohrmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung (IfS), Frankfurt am Main.
Inhalt 6
1. Einleitung 10
1.1 Logozentrismus der Philosophie? 13
1.2 Politik und Politisches 17
1.3 Der »affective turn« 19
2. Mitleid und Terror – Hannah Arendts Analyse der Französischen Revolution 28
2.1 Wie einen Anfang machen? Das Problem revolutionärer Legitimation 32
2.1.1 Echtes Mitleid (compassion) mit dem anderen, sentimentales Bedauern ( pity) mit dem Kollektiv 41
2.1.2 Affektive Differenzierung, Terror und Paranoia: Die Doppelfunktion des Mitleids für die französischen Revolutionäre 43
2.2 Solidarität statt Mitleid 48
2.3 Die historische Kontingenz des Mitleidsbegriffs 51
2.3.1 Emotionstheoretischer Diskurs nach Descartes 52
2.3.2 Emotionstheoretischer Diskurs nach Rousseau 58
2.4 Volonté générale und rousseauistische Einfühlung – eine alternative Lesart der Französischen Revolution 68
3 Emotionen und Theatralität – ästhetische Emotionen in Theatralitätsdiskursen des 18. und 20. Jahrhunderts 76
3.1 Von »Affekt« zu »Emotion« – affekttheoretischer Umbruch zwischen Barock und Aufklärung 77
3.1.1 Die Konditioniertheit ästhetischer und politischer Emotionen 80
3.1.2 Genuss statt Aktion – die Positionen von Nicolai und Mendelssohn 89
3.2 Die affizierte Zuschauerhaltung 101
4. Handlungsunfähigkeit in der Moderne 105
4.1 Handeln und die Folgen: Arendt 109
4.2 Der cartesianische Split als Signatur einer Moderneerfahrung 116
4.3 Reflexion, Wahnsinn und Melancholie – das Zerfallen der Handlung im Trauerspiel: Benjamin 117
4.4 Der entscheidungsunfähige Hamlet: Adorno 121
4.5 Der Paradigmenwechsel in der Affektkonzeption – inneres Movens statt äußerem Affekt 123
5. Vom Affektivwerden der Vernunft – Achtung und Enthusiasmus bei Kant 129
5.1 Achtung als moralisches Gefühl in der Kritik der praktischen Vernunft 135
5.1.1 Achtung als distinktes Gefühl 138
5.2 Achtung als Perspektive auf das Praktischwerden des Gesetzes 140
5.2.1 Der Status des subjektiven Grundes 142
5.2.2 Subjektwerdung jenseits des Lustprinzips – die Unterwerfung unter das Gesetz 148
5.3 Objektlose Gefühle – Achtung und Erhabenes 150
5.3.1 Das Erhabene als Phänomen der Autoaffektion 152
5.3.2 Zwei unterschiedliche Freiheitskonzeptionen Kants: Freiheit als Handeln nach dem Gesetz – Freiheit als Handeln unter einer Idee 161
5.3.3 Die Doppelbestimmung von Freiheit als transzendentaler und normativer Kategorie 163
5.3.4 Das Problem der Selbstdeutung der freien Handlung 164
5.4 Enthusiasmus und Revolution 168
5.4.1 Enthusiasmus als Zuschaueremotion 172
5.4.2 Die Struktur des politischen Urteils als affektivem Urteil 175
5.4.3 Enthusiastisches Urteil versus Akklamation des Spektakels 183
5.5 »… denn sie wissen nicht, was sie tun« – revolutionäres Handeln aus Enthusiasmus 187
6 Exkurs: Aktivierung und Politisierung 197
7 Fazit 202
Literatur 211
Dank 217
1. Einleitung
Am 17. Dezember 2010 kommt es in Sidi Bouzid, einer 250 Kilometer südlich von Tunis gelegenen Stadt, zu einer dramatischen Szene: Der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi setzt sich auf dem Marktplatz selbst in Brand, um gegen zu hohe Lebensmittelpreise zu protestieren. Dieses Ereignis löste Proteste in und über Tunesien hinaus aus und mündete schließlich in den politischen Revolutionen der arabischen Welt: Autokratische Regierungen wurden gestürzt, Demokratiebewegungen gewannen an Boden. Die Bilder, die vom 'Arabischen Frühling' um die Welt gingen, zeigten Protestierende, denen Wut und Empörung ins Gesicht geschrieben war. Doch nicht nur Aufstände oder Revolutionen, die zum Umsturz von Regierungen führten, sind ohne Affekte und Emotionen nicht zu denken. Auch die sich im Zuge der Banken- und Finanzkrise formierenden sozialen und politischen Bewegungen mit ihrer weltweiten Resonanz sind ohne Affekte und Emotionen nicht erklärbar. Den Demonstranten, ihrem Zorn, ihrem verletzten Gerechtigkeitssinn und auch ihrem Veränderungswillen schlugen Sympathie oder Antipathie entgegen: Sie wurden unterstützt oder diskreditiert.
Diese Beispiele sind jüngeren Datums und Teil demokratischer Bewegungen oder Prozesse. Trotzdem wäre die Schlussfolgerung vorschnell, Affekte und Emotionen seien per se demokratisch oder tragen zwingend zu einer lebendigeren Demokratie bei. Denn selbstverständlich sind auch totalitäre Systeme auf Emotionen angewiesen, um ihre Diktatur zu stabilisieren oder um ein National- und Gemeinschaftsgefühl, Hass oder Massenhysterie zu erzeugen. Emotional aufgeladene Auftritte, wie die 'Sportpalastrede' von Joseph Goebbels oder die Aufmärsche und Inszenierungen anlässlich der Nürnberger Reichsparteitage der NSDAP, sind zweifellos ein bedeutender Teil nationalsozialistischer Propaganda gewesen.
Doch sowohl bei Emotionen, die einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung zuträglich sind, als auch bei solchen, die ihr abträglich sind, muss nicht entscheidend sein, wie stark oder bei wie vielen Menschen die affektive Amplitude ausschlägt. Einerseits kann ein Klima der Angst und des Misstrauens, wie es das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR oder die Securitate in Rumänien durch die Überwachung der eigenen Bevölkerung verbreiteten, für autoritäre Systeme überlebenswichtig sein. Die Massentrauer in Nordkorea nach dem Tod von Staatspräsident Kim Jong Il zählt ebenfalls zu diesen Phänomenen. Andererseits haben auch politische Prozesse und Entscheidungen um Infrastrukturprojekte wie 'Stuttgart 21' affektive Resonanz hervorgebracht. Das gilt genauso für die Weigerung der Bürgerrechtlerin Rosa Parks im Jahr 1955, ihren Platz in einem Bus aufzugeben. Letztlich begann mit diesem Protest eine Entwicklung, an deren Ende die Aufhebung der Gesetze zur rassistischen Segregation in den USA stand. Sogar sich aus Unternehmungslust oder Sorge um die Nachbarschaft im eigenen Stadtteil zu engagieren, kann Zeichen einer emotionalen Einstellung oder Bindung in einem kleineren Rahmen sein. Jeder tagespolitische Appell an den Bürgersinn richtet sich an ein solches Gefühl. Doch auch wenn man aus Rachsucht einen renegaten Nachbarn denunziert, sind Emotionen im Spiel.
Revolutionen, seien sie geglückt oder nicht, sind vielleicht diejenigen politischen Ereignisse, für die Affekte und Emotionen besonders wichtig sind: als unmittelbare Motivation, die Menschen zum Handeln zu bewegen. Doch offensichtlich sind Politik sowie Affekte und Emotionen, ob nun positiv oder negativ, eng miteinander verknüpft - nicht nur in revolutionären Momenten, sondern auch auf ganz basaler Ebene. Die beliebte Behauptung, Emotionen seien für den modernen, rationalen Menschen nachrangig, erscheint also wenig plausibel.
Gerade die Erfahrungen des Totalitarismus im 20. Jahrhunderts und die Instrumentalisierung von Emotionen durch die nationalsozialistische Propaganda haben, so lassen sich die Theorien von Hannah Arendt und Jürgen Habermas verstehen, eine beträchtliche Skepsis gegenüber Emotionen in der politischen Öffentlichkeit hervorgerufen. Emotionen schienen sich allzu leicht zur Manipulation und Agitation nutzen zu lassen, als dass man ihnen eine positive Wirkung in der Politik hätte zugestehen können. Einer demokratischen Politik sei also mit einer Sphäre rationaler Argumentation besser gedient. Wie erfolgreich ein solcher Ausschluss der Emotionen aus der politischen Öffentlichkeit sein kann, ist fraglich. Denn wiewohl historisch nachvollziehbar, ist diese Annahme falsch. Emotionen sind aus der Politik überhaupt nicht herauszulösen. Die aufgezählten Beispiele sollen für diese These werben, dafür Argumente zu formulieren, ist das Ziel dieses Buches.
Darüber hinaus wirft die verbreitete Skepsis gegenüber Emotionen die Frage auf, welchen Autorinnen und Autoren und welchen Argumenten der Ausschluss der Emotionen aus der Politik ideengeschichtlich geschuldet ist. Für die politische Theorie hat auch in dieser Hinsicht sicherlich das Denken Immanuel Kants einen zentralen Stellenwert besessen, und vom kantischen Verdikt, die Emotionen seien die 'Krebsschäden der Vernunft', hat sich der Forschungsgegenstand bis heute nicht vollständig erholt. Kants Polemik gegen die angebliche Irrationalität der Emotionen hat sie lange als philosophischen Gegenstand desavouiert, und auch durch die Aufklärungskritik seitens der Kritischen Theorie kam es nicht zu einer Wiederbelebung der Emotionstheorie. Gerade in der politischen Philosophie konnte sich die Inklusion von Emotionen lange Zeit nicht gegen den rationalistischen Überhang behaupten, so spielen sie etwa bei John Rawls keine Rolle
1.1 Logozentrismus der Philosophie?
Gerade Vertreter der neueren Philosophie der Emotionen verweisen immer wieder auf den rationalistischen Überhang der nachplatonischen und nachkantischen Theorie, der eine generelle Abwehrhaltung der Philosophie gegenüber Emotionen begründe. Dabei handelt es sich jedoch um eine Fehleinschätzung, die auf einer Art rückwirkender Projektion einflussreicher nachkantischer Philosophie beruht. Denn es wird leicht übersehen, wie die neuere philosophische Emotionsforschung an eine reiche Vorgeschichte anknüpfen kann. So stimmt es keinesfalls, dass die Philosophie per se, von Platon bis heute, emotionsfeindlich sei.
Die Renaissance, die das (politische) Denken Baruch de Spinozas mittlerweile erlebt, zeugt von der philosophiehistorischen Bedeutung der Emotionen. Kursorisch sei auf die Leidenschaften bei David Hume verwiesen: Seine These, die menschliche Vernunft sei 'a slave of the passions', ist gerade nicht abschätzig gemeint, sondern impliziert, man müsse den Emotionen von vornherein mehr Aufmerksamkeit bei der Untersuchung menschlichen Handelns schenken. Die Thesen der englischen moral-sense-Theoretiker schließlich können gar nicht von einer Emotionstheorie getrennt werden. Doch auch im Denken anderer Philosophen, selbst nach der Aufklärung, waren Emotionen zentral, man denke etwa an die nietzscheanische Kategorie des Dionysischen oder an die Bedeutung, die Schopenhauer dem Mitleid zubilligt. Die überaus lebendige Rolle, die Emotionen in anderen Teildisziplinen der Philosophie wie der philosophischen Ästhetik gespielt haben, muss ebenso berücksichtigt werden. Selbst bei Platon und Kant ist die Ablehnung von Emotionen weniger ausgeprägt, als es prima facie wirkt. Den abschätzigen Bemerkungen Platons über die Emotionen in der Politeia stehen die wertschätzenden Ausführungen über Liebe und Freundschaft im Gastmahl gegenüber. Auch in der Kant-Rezeption tritt in den Hintergrund, dass sich Kant, trotz offen ausgesprochener Geringschätzung der Emotionen, in seiner Philosophie an zentralen Stellen seiner Theorie der praktischen Vernunft und seiner Geschichtsphilosophie auf Emotionen und Affekte bezieht. Übersieht man seine intensive Beschäftigung mit Affekten, so lautet meine These, bleiben wichtige Überlegungen Kants zur politischen Theorie und zur Handlungstheorie verborgen.
Von einer generellen Abwehrhaltung der Philosophie gegenüber Emotionen kann also nicht gesprochen werden. Wenn allerdings in der Philosophie über Politik und Emotionen im Zusammenhang nachgedacht wird, werden Emotionen oder eine besondere Emotion analysiert und in die jeweilige politische Theorie eingebettet. Einige unterschiedliche philosophiehistorische Beispiele dafür sind die Funktion der Ehre bei Machiavelli, die Angst im hobbesschen Naturzustand sowie das Mitleid in Rousseaus 'Diskurs über die Ungleichheit'. Emotionen haben eine bestimmte Funktion innerhalb dieser Theorie oder werden vor dem Hintergrund bestimmter politiktheoretischer Annahmen bewertet. Klassiker jüngeren Datums sind Judith Shklars Liberalism of Fear oder Hannah Arendts Analyse des Mitleids in der Französischen Revolution. Inhaltlich bleibt gerade die emotionstheoretische Seite in diesen Beschreibungen von Politik und Emotionen unterbestimmt; Emotionen werden als Alltagserfahrungen oder anthropologische Grundtatsachen charakterisiert. Damit wurde allerdings lange Zeit nicht hinreichend gewürdigt, auf welchen emotionstheoretischen Prämissen die Aussagen über Emotionen in der Politik beruhen.
Verschiedene Philosophinnen und Philosophen, sowohl aus der theoretischen als auch aus der praktischen Philosophie - Martha Nussbaum ist wohl die prominenteste unter ihnen -, haben in den letzten dreißig und verstärkt seit zehn Jahren eine Korrektur zugunsten der Emotionstheorie angemahnt.
Nussbaum untersucht beispielsweise, wie Liebe und Mitgefühl in das Politische integriert werden können. Doch sie gewinnt ihre emotionstheoretischen Prämissen auch aus Beschreibungen, die keinen spezifisch politischen Kontext haben. Anders gesagt, die implizite Prämisse von Arbeiten wie jener von Nussbaum lautet, die Ergebnisse einer Untersuchung von Emotionen im Privaten seien einfach auf das Politische übertragbar. Hält man als eine der Minimalforderungen politischer Theorie aber fest, dass sie die Differenz zum Privaten markieren muss, ist mit guten Gründen zu bezweifeln, ob überhaupt etwas über Politik und Emotionen gesagt ist, wenn man ein Modell von Emotionen aus dem nicht-politischen Bereich zugrunde legt. Es scheint einen gewissen privatistischen Überhang zu geben.
Bei neuesten Forschungstrends wie dem New Materialism zeigt sich wiederum das gegenteilige Problem. Sie gehen zwar vordergründig von eigenständigen emotionstheoretischen Begrifflichkeiten (im Anschluss an Gilles Deleuze) aus. Doch selbst diese sind, wie ich zeigen werde, stärker historisch geprägt, als die Autoren ausweisen. Hier liegt der blinde Fleck also, wie bei den Klassikern der politischen Theorie, bei den Vertretern der Emotionstheorie.
In beiden Fällen wird die wesentliche Pointe geradezu verschenkt: Sowohl das Politische als auch die Emotionen müssen im Rahmen eines Modells von Politik und Emotionen von Anfang an in den Parametern dieses Modells gedacht werden. Gerade der Ansatz, entweder von der politischen Theorie oder von der Emotionstheorie auszugehen und dann die Konsequenzen in ein Modell von Politik und Emotionen zu integrieren, übersieht, wie originell eine solche Untersuchung sein kann.
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich weder um eine Phänomenologie politischer Emotionen, in der die genannten Beispiele näher untersucht und kategorisiert würden, noch um eine Motivgeschichte, die einzelne Autoren mit Blick auf ihre Thesen zu Politik und Emotionen rekonstruieren würde. Meine Argumentation ist nicht normativ in dem Sinne, dass sie für eine emotionalisierte Politik plädiere oder für ein 'Mehr Emotionen wagen!' eintrete. Ich weise allerdings Hannah Arendts These zurück, nach der Politik und Emotionen in einem Verhältnis gegenseitiger Destruktion stehen. Im Moment der Revolution sind es für Arendt die Emotionen, die die Ereignisse eskalieren lassen, die Situation destabilisieren und so zum Scheitern der Revolution führen. In ihrer Analyse der Französischen Revolution spielt das Mitleid eine entscheidende - und fatale - Rolle. Meine Lektüre Arendts zeigt, auf welchen Voraussetzungen die Annahme beruht, Politik und Emotionen stünden in einem destruktiven Verhältnis zueinander. Bei genauerer Betrachtung wird offenkundig, dass Arendts vordergründig plausibles Modell auf voraussetzungsreichen emotions- und politiktheoretischen Prämissen beruht. Kritisiert man diese Prämissen, werden die Alternativen sichtbar. Die impliziten Annahmen, die Arendts Analyse des Verhältnisses prägen, sind gerade für ein common-sense-Verständnis von Emotionen exemplarisch.
Um zu verdeutlichen, dass Arendts Verständnis von Emotionen nicht alternativlos ist, werde ich die im 18. Jahrhundert virulente Debatte in der Ästhetik um Emotionen und deren Aufgabe im Trauerspiel einbeziehen. Aus dieser Kritik entwickele ich anhand des Briefwechsels zwischen Moses Mendelssohn, Friedrich Nicolai und Gotthold Ephraim Lessing über die Aufgabe des Trauerspiels sowie anhand ausgewählter Texte von Kant ein Modell, das zeigt, dass dem Politischen eine spezifische Struktur von Öffentlichkeit eigen ist, nämlich eine solche, die aus Handelnden und Zuschauern besteht. Für beide Seiten sind Emotionen konstitutiv, und umgekehrt werden Emotionen im Politischen als Handlungs- und Zuschaueremotion wirksam. Deswegen gilt den ästhetischen Emotionen das besondere Augenmerk des vorliegenden Buches. Da die Ästhetik sich unter anderem mit der Rezeptionshaltung beschäftigt, lassen sich dort Hinweise finden, was die Spezifizität der Zuschaueremotion ausmachen kann.
Für Kant, der die Französische Revolution sein Leben lang positiv bewertet hat, waren es nicht die Akteure, sondern die Unbeteiligten, die mit ihrem Enthusiasmus feststellten, dass es sich um ein historisch bedeutsames Ereignis handelte. Kant deutet in seiner Analyse der Französischen Revolution ein ganz anderes, genuin politisches Zusammenspiel von Politik und Affektivität an. Deswegen interpretiere ich Kants Theorie der Achtung und Kants Theorie des Enthusiasmus in der Französischen Revolution. So kann ich veranschaulichen, was für ein Verständnis von Politik und Affektivität es erlaubt, beide in einem konstitutiven Verhältnis zu verstehen.
Arendt und Kant stehen im Mittelpunkt meiner Untersuchung. Trotzdem handelt es sich nicht um ein Buch, welches ausschließlich untersucht, wie Affekte und Emotionen sowie Politik im Werk beider Philosophen verknüpft sind. In Abgrenzung zu Arendt und anhand von Kant ermittle ich, welche Rolle Affektivität für politisches Handeln und Urteilen spielt. Ich erarbeite also eine Vorstellung von Affektivität anhand eines Politikmodells und schärfe umgekehrt den Begriff des Politischen durch ein bestimmtes Verständnis von Affektivität.
1.2 Politik und Politisches
Das Buch setzt bei Arendts und Kants Analysen der Französischen Revolution an. Die Revolution, so legen beide Denker nahe, versteht sich selbst als Gründungsmoment einer freiheitlichen Ordnung - ob zu Recht oder zu Unrecht, darüber gehen die Einschätzungen der beiden Denker auseinander. Im Augenblick der Revolution wird exemplarisch deutlich, was eine politisch freie Handlung sein kann, was ihre Bedingungen sind und wodurch sie gekennzeichnet ist. Politische Ordnungen werden dabei aber nicht auf ihre spektakulären Urszenen reduziert. Die Revolution katalysiert allerdings die (emotionalen, affektiven) Kräfte, die politisch wirksam werden können, und bringt so deren destruktive oder konstitutive Seiten besonders zur Geltung. So erklärt sich wohl Arendts und Kants Faszination für die Revolution und so erklärt sich auch, warum ihre Schriften Gegenstand meiner Untersuchung sind. Die Ergebnisse, zu denen Arendt und Kant kommen, lassen sich allerdings verallgemeinern und auf die Funktion anwenden, die Emotionen und Affekten auch außerhalb des revolutionären Ausnahmezustands im Politischen zukommt.
Ich verwende die Begriffe 'Politik' und das 'Politische' weitgehend synonym. Die Dichotomie zwischen real existierender Politik, die größtenteils zur Verwaltung, zum Ausführen von Sachzwängen und Zwangsmaßnahmen regrediert, und einem utopischen Begriff des Politischen, der aber gerade nicht in der Politik zu verwirklichen ist, vermeide ich. Politik und Politisches werden hier nicht in dem Sinne unterschieden, dass Politik immer das unvollständige und defizitäre Korrelat zu einem utopischen Begriff von Politik ist, wie in Jacques Rancières Unterscheidung von Politik und Polizei oder bei Alain Badious Bestimmung des historisch-politischen Ereignisses. Die Ansätze von Badiou und Rancière haben andere Pointen und Schwerpunktsetzungen. In diesem Buch geht es mir darum, einen Politikbegriff zu entwickeln, der in einer dichotomen Unterscheidung von real existierender Politik und utopischem Politischen nicht zur Geltung kommen würde. Dabei konzentriere ich mich auf den Begriff der politischen Handlung. Im Politischen, so lautet meine These, die ich mit Kant entwickele, spaltet sich eine Handlung in ihren praktischen und ihren beurteilenden Aspekt: Erst durch die Reaktion der Zuschauer wissen wir, laut Kant, dass in der Französischen Revolution frei gehandelt wurde.
Die Französische Revolution, schreibt Kant, sei ein politisches Ereignis, weil in ihr eine freiheitliche politische Handlung stattgefunden hat. Deswegen habe es eine politische Öffentlichkeit gegeben, die enthusiastisch reagierte. Das politische Urteil der Öffentlichkeit besteht, so die Pointe Kants, in ihrem Enthusiasmus. Affektivität ist konstitutiv für politisches Handeln, und zwar sowohl für das Urteil der Zuschauer als auch für die Taten der Akteure. Wir verstehen also nur, was eine politische Handlung ist, wenn wir das affektiv geprägte Zusammenspiel von Akteuren und urteilenden Zuschauern in den Blick nehmen.
Das Verhältnis von Politik und Affektivität so zu analysieren, dass es aus einem affektiv geprägten Zusammenspiel von Zuschauen und Handeln besteht, soll ermöglichen, spektakelhaften Zügen oder Forderungen nach maximaler Partizipation argumentativ zu begegnen. Denn beides beruht auf einem, wie ich zeigen werde, defizitären Verständnis von Politik und Affektivität.
1.3 Der 'affective turn'
In den letzten zehn bis zwanzig Jahren haben sich Affekte als Forschungsgegenstand in den Geisteswissenschaften etabliert. P. T. Clough und Jean Halley sprechen sogar von einem 'affektive turn'. Dabei haben sie sich als höchst facettenreicher Untersuchungsgegenstand erwiesen. Außerhalb der Philosophie sind hier die Arbeiten der Soziologin Eva Illouz und der Historikerin Ute Frevert zu nennen. In der Philosophie markieren Anthony Kennys Actions, Emotions, and the Will aus dem Jahr 1963 sowie der 1976 von Amelie Oksenberg-Rorty herausgegebene Sammelband Explaining Emotions einen Anfang. Seit den 1980er-Jahren ist die Emotionsforschung geradezu explodiert, wie sich an der Fülle der Publikationen und der abgehaltenen Tagungen und Konferenzen zeigt. Auch das von der DFG geförderte Exzellenzcluster 'Languages of Emotions' (2007 bis 2014) und der Sonderforschungsbereich 'Affective Societies - Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten' (2015 bis voraussichtlich 2019) sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen.
Trotz des 'affective turn' und der zahlreichen Forschungsarbeiten sind selbst basale begriffliche Abgrenzungen im Bereich der Emotionstheorie nach wie vor schwierig. Gegen eine Typologie politischer oder politisierbarer Emotionen habe ich mich aus den gleichen Gründen entschieden, die Ronald de Sousa in seinem Standardwerk Die Rationalität des Gefühls aufführt:
'Eine Möglichkeit die [Erstellung einer Typologie, J. M.] zu gewährleisten, wäre das bereits skizzierte atomistische Verfahren: eine Liste elementarer Gefühle zu finden und die anderen aus diesen zu konstruieren. Descartes' Auswahl von Elementen (Verwunderung, Liebe, Hass, Begierde, Freude und Traurigkeit) ist nicht plausibel, aber andere Klassifikationen haben vier, acht oder zehn elementare Gefühle unterschieden. Die meisten Listen gleichen sich, was die Aufnahme von Angst und Wut oder Zorn anbetrifft, aber keine zwei davon decken sich völlig, und alle sind etwa gleich plausibel [...]. Angesichts dieser Vielfalt erscheint jede Liste als völlig willkürlich.'
Zwar bezieht sich de Sousa auf basale Gefühle, die als Grundlage für alle übrigen gelten sollen. Das Grundproblem, dass Typologien von Emotionen stets etwas Willkürliches anhaftet, scheint mir jedoch universell zu sein.
Geht es in der Emotionstheorie darum zu bestimmen, was eine Emotion ist, wird, so hat es den Eindruck, zunächst darum gerungen, nach welchen Kriterien unterschieden werden soll. So gibt es erstens Differenzierungen von Affekt, Emotion, Stimmung, Atmosphäre und Laune. Zweitens beschäftigt man sich damit, wie Emotionen zustande kommen. Diese Fragen sind hauptsächlich physiologisch-neurologischer Natur - es wird beispielsweise diskutiert, ob man auch im bewusstlosen Zustand eine Emotion als physisches Korrelat durchlaufen kann. Und drittens geht es um Differenzierungen von verschiedenen Emotionen und ihrem Erleben. Bei dieser Aufschlüsselung handelt es sich aber lediglich um Forschungstrends; jede Richtung der Emotionstheorie nimmt ohnehin ihre eigenen begrifflichen Bestimmungen vor.
Grundlegend differenziert wird häufig zwischen Affekt und Emotion. Affekte werden gegenwärtig meist als rohe, kulturell, kognitiv und persönlich unbearbeitete Form einer reinen Intensität verstanden. Unter Emotion hingegen fasst man die versprachlichte Form eines Gefühls. Interessanterweise halten sich sowohl die Vertreter einer neurowissenschaftlich inspirierten Emotionstheorie (Tomkins/Ekman und das Paradigma der 'basic emotions') als auch diejenigen, die sich an Deleuze orientieren, an diese Prämissen (Massumi u. a.). Diese Dichotomie ist aber, wie ich zeigen werde, nicht zu halten. Es ist, mit Kant gesprochen, unplausibel, von einer solchen Vorstellung von einem Affekt auszugehen, weil sich eine Figur reiner Affektivität nicht mit Geist und Körper verbinden lässt. Auch die damit einhergehende Hoffnung, den Affekt als das ganz andere, das allem, was politisch und sozial konditioniert ist, entkommt bzw. vorausgeht, bestimmen zu können, ist damit hinfällig. Das Revolutionäre des Affekts liegt, wie ich mit Kant zeige, an anderer Stelle.
Wenn ich von Emotionen und Affekten spreche, meine ich damit affektive Phänomene; zwischen Emotionen, Stimmungen, Gefühlen und Leidenschaften im engeren Sinn wird also nicht unterschieden. Diese Untersuchung erkennt dadurch an, dass es keine trennscharfe Unterscheidung zwischen Stimmungen, Emotionen, Affekten und Gefühlen gibt. So schreibt beispielsweise Ute Frevert zur Binnendifferenzierung in der Psychologie:
'The science of psychology upon which the authors of encyclopedias draw has a wide variety of definitions and explanations. Each psychological tendency uses its own terms as it sees fit, and lends them a different theoretical status. So, for instance, many researchers are inclined to separate feeling from emotion and ascribe to it a stronger substantive consciousness. Here we find a revival of the old philosophical debate over lower (physical) and higher (mental) emotions that was not settled even in the twentieth century.'
Freverts Aussage stammt aus einem Aufsatz über die enzyklopädische Einordnung verschiedener Begriffe der Emotionstheorie. Sie deutet, neben der idiosynkratischen Verwendung der Terminologie, noch auf einen anderen Trend hin: eben dass die Deutungshoheit, die die Philosophie bis in 18. Jahrhundert über die Emotionstheorie hatte, weitgehend an die empirischen Wissenschaften der Psychologie und Neurologie abgegeben wurde. In der Folge scheint auch in der geisteswissenschaftlichen Emotionsforschung der Schulterschluss mit der empirischen Forschung nahegelegen zu haben. In diesem Buch folge ich diesem Trend jedoch nicht. Stattdessen werde ich den Akzent auf einen bestimmten Zweig der philosophischen Emotionstheorie legen, nämlich den der ästhetischen Emotionen.
| Erscheint lt. Verlag | 12.11.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Arendt • Aristoteles • Descartes • Emotion • Handlungstheorie • Hannah Arendt • Immanuel Kant • Kant • Moderne • Philosophie • Politik • Politische Theorie • Revolution • Rousseau • Theatertheorie |
| ISBN-10 | 3-593-43336-2 / 3593433362 |
| ISBN-13 | 978-3-593-43336-3 / 9783593433363 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich