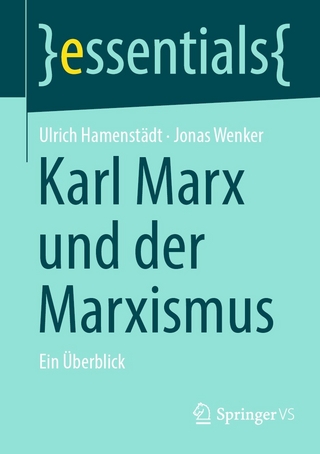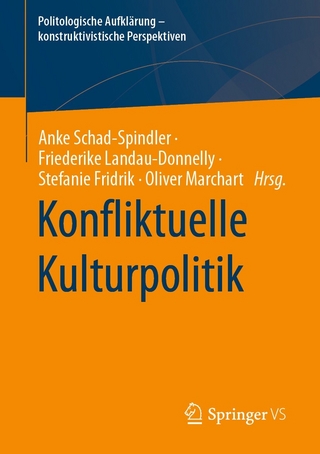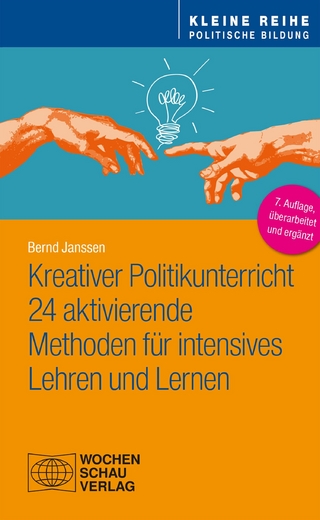Kommende Nachhaltigkeit (eBook)
576 Seiten
Nomos Verlag
978-3-8452-5730-3 (ISBN)
Cover 1
Teil A: Nachhaltigkeit neu denken 21
1. Einleitung: nachhaltige Entwicklung als Leerformel? 21
2 Theoretische Orientierungen 23
2.1 Nachhaltigkeit als Diskurs begreifen 23
2.2 Prämissen transparent machen 32
2.3 Diskursstränge verknüpfen 41
3. Forschungsziele und eigenes Nachhaltigkeitsverständnis 47
4. Forschungszugang, Methode und Aufbau der Arbeit 51
Teil B: Diskursfeld nachhaltige Entwicklung 69
Diskursstrang B.I: Nachhaltigkeit als politisch-institutioneller Diskurs – Analyse politischer Nachhaltigkeitsdokumente 69
1. Der Brundtland-Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ von 1987 71
1.1 Historischer und politischer Kontext 71
1.2 Ökonomieverständnis 73
1.3 Politikverständnis 82
1.4 Gerechtigkeitsverständnis 88
2. Die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von 1992: die Rio-Deklaration und die Agenda 21 95
2.1 Historischer und politischer Kontext 95
2.2 Ökonomieverständnis 99
2.3 Politikverständnis 105
2.4 Gerechtigkeitsverständnis 111
3. Die europäischen Nachhaltigkeitsstrategien von 2001 und 2006 119
3.1 Historischer und politischer Kontext 119
3.1.1 Die europäische Nachhaltigkeitsstrategie 2001 121
3.1.2 Zum Verhältnis zwischen der Lissabon-Strategie (2000) und der Göteborger Nachhaltigkeitsstrategie (2001) 123
3.1.3 Die erneuerte europäische Nachhaltigkeitsstrategie von 2006 124
3.2 Ökonomieverständnis 125
3.3 Politikverständnis 135
3.4 Gerechtigkeitsverständnis 139
4. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für Deutschland“ von 2002 143
4.1 Historischer und politischer Kontext 143
4.1.1 Entwicklung des politisch-institutionellen Diskurses um Nachhaltigkeit in Deutschland in den 1990er-Jahren 143
4.1.2 Entstehungszusammenhang der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und die Rolle des Nachhaltigkeitsrates 144
4.1.3 Kernelemente der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 146
4.2 Ökonomieverständnis 147
4.3 Politikverständnis 155
4.4 Gerechtigkeitsverständnis 158
5. Der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung von 2002: die Johannesburg-Deklaration und der Plan of Implementation 163
5.1 Historischer und politischer Kontext 163
5.2 Ökonomieverständnis 165
5.3 Politikverständnis 175
5.4 Gerechtigkeitsverständnis 180
6. Zwischenfazit I 188
6.1 Kontinuitäten, diskursive Veränderungen, Widersprüche 188
6.1.1 … in den Ökonomieverständnissen 188
6.1.2 … in den Politikverständnissen 190
6.1.3 … in den Gerechtigkeitsverständnissen 192
6.2 Bausteine für ein kritisch-emanzipatorisches Konzept nachhaltiger Entwicklung aus dem politisch-institutionellen Diskursstrang 193
6.2.1 Neues Ökonomie- und Arbeitsverständnis 193
6.2.2 Partizipation und innovatives politisches Potenzial 194
6.2.3 Vorsorgeprinzip 195
6.2.4 Menschenrechte und kosmopolitische Demokratie 196
Diskursstrang B.II: Diskursinterventionen – skeptische und ablehnende Stimmen im deutschen Diskurs um nachhaltige Entwicklung 198
1. Kritik am herrschenden Nachhaltigkeitsdiskurs aus den Bereichen Internationalismus-Bewegung und postmoderne Wissenschaft 199
1.1 Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) 200
1.1.1 Zum Hintergrund der BUKO 200
1.1.2 Hauptkritikpunkte der BUKO am Konzept nachhaltiger Entwicklung 202
1.2 Johannes Dingler 207
1.2.1 Postmoderne Theorie als Basis für Nachhaltigkeitsforschung 207
1.2.2 Kritik am hegemonialen Konzept nachhaltiger Entwicklung als Ausdruck ökologischer Modernisierung 208
2. Alternative Perspektiven für sozial-ökologische Transformationen 213
2.1 BUKO: Abwicklung des Nordens 214
2.2 Joachim Hirsch: Radikaler Reformismus 218
2.3 Ulrich Brand: Gegen-Hegemonie 220
3. Zwischenfazit II 226
3.1 Zur Kritik der Kritik 227
3.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 228
3.2.1 Facetten von Herrschaftskritik: Kapitalismuskritik, Staatskritik und Skepsis gegenüber Kooperationsmodellen 228
3.2.2 Ablehnung des hegemonialen, des herrschenden oder des gesamten Diskurses? 235
3.3 Bausteine für ein kritisch-emanzipatorisches Konzept nachhaltiger Entwicklung aus dem diskursinterventionistischen Diskursstrang 236
3.3.1 Widerstand und Gegenmacht durch Selbstorganisation 236
3.3.2 Materialistische Fundierung der Menschenrechte 237
Diskursstrang B.III: Diskurs um Nachhaltigkeit und Gender – feministische Kritiken und Alternativen 239
1. Spurensuche: (inter)nationale feministische Diskurse zu Umwelt und Entwicklung 242
1.1 Entstehungshintergründe und Entwicklung der Genderdimension im deutschen Nachhaltigkeitsdiskurs 242
1.2 Der Bielefelder Subsistenzansatz 250
2. Vorsorgendes Wirtschaften: Netzwerk und theoretisches Konzept 256
2.1 Genese und politischer Kontext 256
2.2 Ökonomieverständnis 258
2.3 Politikverständnis 263
2.4 Gerechtigkeitsverständnis 270
3. Frauenökonomie 275
3.1 Genese und theoretischer Kontext 275
3.2 Ökonomieverständnis 278
3.3 Politikverständnis 282
3.4 Gerechtigkeitsverständnis 286
4. Sustainable Livelihoods als Grundlage nachhaltiger Entwicklung: der DAWN-Ansatz 290
4.1 Genese und politischer Kontext 290
4.2 Ökonomieverständnis 292
4.3 Politikverständnis 298
4.4 Gerechtigkeitsverständnis 309
5. Zwischenfazit III 317
5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 318
5.1.1 … in den Ökonomieverständnissen 318
5.1.2 … in den Politikverständnissen 319
5.1.3 … in den Gerechtigkeitsverständnissen 321
5.2 Diskursive Besonderheit: die Rezeption des Sustainable-Livelihoods-Ansatzes 322
5.3 Bausteine für ein kritisch-emanzipatorisches Konzept nachhaltiger Entwicklung aus dem feministischen Diskursstrang 325
5.3.1 Das Ganze der Ökonomie 325
5.3.2 Neue politische Partizipationskultur 326
5.3.3 Erweiterungen von Gerechtigkeit: Ethik der Für_Sorge und Ökologische Gerechtigkeit 327
Diskursstrang B.IV: Integrative Nachhaltigkeitsansätze – mehr als nur ökologische Modernisierung 329
1. Das integrative Nachhaltigkeitskonzept der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) 331
1.1 Entstehungskontext und Grundzüge des HGF-Konzepts 331
1.2 Ökonomieverständnis 334
1.3 Politikverständnis 343
1.4 Gerechtigkeitsverständnis 349
2. Die Greifswalder Theorie starker Nachhaltigkeit von Konrad Ott und Ralf Döring 358
2.1 Entstehungskontext und Grundzüge der Theorie starker Nachhaltigkeit 358
2.2 Ökonomieverständnis 361
2.3 Politikverständnis 369
2.4 Gerechtigkeitsverständnis 377
3. Der Osnabrücker Ansatz von Mohssen Massarrat: Nachhaltigkeit als revolutionäre Reform 383
3.1 Entstehungskontext und Grundzüge des Ansatzes von Massarrat 383
3.2 Ökonomieverständnis 385
3.3 Politikverständnis 392
3.4 Gerechtigkeitsverständnis 399
4. Das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE): Soziale Ökologie und das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse 405
4.1 Entstehungskontext und Grundzüge der Sozialen Ökologie als Wissenschaft von den gesellschaftlichen Naturverhältnissen 405
4.2 Ökonomieverständnis 407
4.3 Politikverständnis 416
4.4 Gerechtigkeitsverständnis 423
5. Zwischenfazit IV 427
5.1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 427
5.1.1 … in den Ökonomieverständnissen 427
5.1.2 … in den Politikverständnissen 428
5.1.3 … in den Gerechtigkeitsverständnissen 429
5.2 Bausteine für ein kritisch-emanzipatorisches Konzept nachhaltiger Entwicklung aus dem integrativen Diskurs 432
5.2.1 Neugestaltung der Arbeit 432
5.2.2 Demokratisierung und Politisierung 432
5.2.3 Intra- und intergenerative Gerechtigkeit als permanent ausgleichende Gerechtigkeit 433
Teil C: Nachhaltigkeit, quo vadis? 435
1. Die UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung von 2012: „The future we want“ 435
1.1 Historischer und politischer Kontext 435
1.2 Ökonomieverständnis 438
1.3 Politikverständnis 446
1.4 Gerechtigkeitsverständnis 448
2. Diskursverläufe 455
2.1 … in den Ökonomieverständnissen 455
2.2 … in den Politikverständnissen 457
2.3 … in den Gerechtigkeitsverständnissen 460
3. Kommende Nachhaltigkeit 463
3.1 Kommende Nachhaltigkeit als Reflexionspostulat und Mehrfachstrategie 463
3.2 Bausteine für ein kritisch-emanzipatorisches Konzept nachhaltiger Entwicklung 466
3.2.1 Das Ökonomische neu denken: für eine erhaltende Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse 466
3.2.2 Das Politische neu denken: für eine demokratische Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse 483
3.2.3 Gerechtigkeit neu denken: für eine gerechte und für_sorgende Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse 490
Bibliographie 503
Internetquellen ohne Autor_innenangabe 575
| Erscheint lt. Verlag | 27.6.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Feminist and Critical Political Economy |
| Verlagsort | Baden-Baden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Theorie |
| Schlagworte | Gender • Nachhaltigkeit • Nachhaltigkeitsdiskurs • Politik • Politikwissenschaft • Politische Theorie |
| ISBN-10 | 3-8452-5730-X / 384525730X |
| ISBN-13 | 978-3-8452-5730-3 / 9783845257303 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich