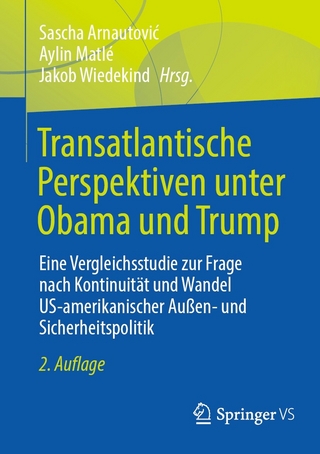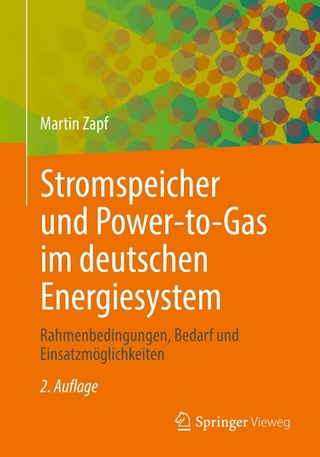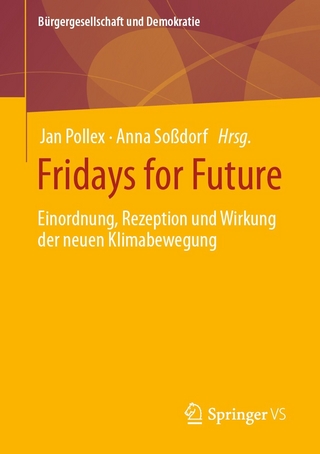Engagement und Zivilgesellschaft (eBook)
VI, 580 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-18474-2 (ISBN)
Prof. Dr. habil. Thomas Klie ist Professor für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft an der Evangelischen Hochschule Freiburg i. Br., Privatdozent an der Universität Klagenfurt/IFF-Wien und Leiter des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) Freiburg/Berlin. Er war Vorsitzender der Zweiten Engagementberichtskommission.Anna Wiebke Klie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centrum für Religion und Moderne (CRM) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie war wissenschaftliche Leiterin der Geschäftsstelle für den Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung am zze.
Inhaltsverzeichnis 6
1 Einleitung Zum Inhalt des Sammelbandes 8
2 Auftrag, Anliegen, Arbeitsweise der Zweiten Engagementberichtskommission 15
3 Engagement in Zahlen 21
1 Einleitung 21
2 Engagement-Ermittlungen: Unterschiedliche Kreise der Engagierten 23
3 Engagement jenseits der Engagement-Untersuchungen:Informelle Hilfen, zivilgesellschaftliche Beteiligung, Spenden 31
4 Quantitative Entwicklung des Engagements 37
5 Qualitative Veränderungen des Engagements 42
6 Engagement im europäischen Vergleich 47
7 Engagement in West- und Ostdeutschland 50
8 Veränderte Rollenbilder: Engagement von Frauen und Männern 53
9 Demografische Entwicklung: Engagement von Jüngeren und Erziehung zum Engagement 58
10 Demografische Entwicklung: Das Engagement von Älteren und für Ältere 66
11 Schichtzugehörigkeit und Engagement: Befestigung sozialer Ungleichheit? 73
12 Engagement von und für Personen mit Migrationshintergrund und für Flüchtlinge 77
13 Motive und Voraussetzungen für das Engagement 84
14 Früheres Engagement und Engagementpotenziale 90
15 Einbettung des Engagements in die Kommunen 94
16 Träger für das Engagement: Vereine, Verbände, Stiftungen 99
Literaturverzeichnis 105
4 Engagement und Bildung 112
1 Einleitung und Klärung zentraler Begrifflichkeiten 112
2 Zur Bildungsrelevanz des bürgerschaftlichen Engagements 116
3 Civic Education in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 120
3.1 Das Modellprojekt ‚Die Kinderstube der Demokratie‘ 122
3.2 Modellprojekt ‚jungbewegt‘ der Bertelsmann Stiftung 123
4 Die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit 126
5 Schule und bürgerschaftliches Engagement 133
5.1 Bürgerschaftliches Engagement in der Schule 134
5.2 Der Ansatz der Demokratiepädagogik 137
5.3 Service Learning – Verantwortung und Lernen durchEngagement (LdE) 138
5.4 Ganztagsschule und Schulentwicklung(innere und äußere Schulöff nung) 143
6 Service Learning an Hochschulen 147
7 Educational und Local Governance in kommunalen Bildungslandschaften 150
8 Handlungsempfehlungen 156
8.1 Einführung 156
8.2 Handlungsempfehlungen für die Bundes- und Landesebene 157
8.3 Empfehlungen für die kommunale Ebene 161
Literaturverzeichnis 162
5 Bürgerkommune 167
1 Einführung 167
2 Bürgerkommune – Ein vielschichtiger und facettenreicher Diskurs 171
2.1 Die Diskussion über die Bürgerkommune als Fortsetzung und Weitung des Diskurses zur Verwaltungsreform 172
2.2 Pragmatische Erweiterung von Bürger-Rollen in einer „Bürgerkommune light“ 180
2.3 Das „Leitbild Bürgerkommune“ als Kondensat der Erfahrungen reformorientier ter Kommunen (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement– KGSt) 187
2.4 Bürgerkommune als ambitioniertes zivilgesellschaftliches Reformprojekt 195
2.5 Bausteine und Phasen in der Entwicklung des Leitbilds „Bürgerkommune“ 196
2.6 Erträge der Debatte 202
3 Refl exionskontexte: Die Diskurse zu „Zivilgesellschaft“, „Welfare Mix“ und „Governance“ 205
3.1 Zivilgesellschaft 205
3.2 Welfare Mix 211
3.3 Governance 215
4 Empirische Befunde zur Entwicklung von Bürgerkommunen und ihren Kernbausteinen 223
4.1 Die Arnsberg/Schwäbisch Gmünd-Studie 224
4.2 Bürgerbeteiligung und repräsentative Demokratie in CIVITAS-Kommunen 225
4.3 Entwicklungen in den einzelnen Bausteinen 228
5 Herausforderungen 241
5.1 Restriktive Rahmenbedingungen überwinden 241
5.2 Bürgergesellschaft stärken 246
6 Ansatzpunkte und Perspektiven 252
6.1 Bürgerkommune als ambitioniertes Reformkonzept: Thesen und Leitsätze 252
6.2 Bürgerkommune als ambitioniertes Reformkonzept: Handlungsempfehlungen 257
Literaturverzeichnis 264
6 Daseinsvorsorge aus rechtswissenschaftlicher Perspektive 273
1 Einführung 273
2 Zusammenfassung 275
3 Begriff der Daseinsvorsorge 278
3.1 Entstehung des Begriffs 278
3.2 Umfang des Begriffs 280
3.3 Art und Transformation des Begriffs der Daseinsvorsorge 282
3.4 Zwischenergebnis 282
4 Gegenstand der Daseinsvorsorge 282
4.1 Unterscheidung nach der Leistung 283
4.2 Differenzierung nach dem Leistungsempfänger 286
4.3 Zwischenergebnis 287
5 Verfassungsrechtliche Vorgaben der Daseinsvorsorge 287
5.1 Grundrechte 288
5.2 Kommunale Selbstverwaltung 289
5.3 Staatsprinzipien und Staatsziele 290
5.4 Zwischenergebnis 294
6 Einfachgesetzliche Regelungen der Daseinsvorsorge 294
6.1 Staatsrechtliche Gesetze 295
6.2 Raumordnungs- und Umweltrecht 296
6.3 Wasserrecht 297
6.4 Verkehrsrecht 297
6.5 Gefahrenabwehr 297
6.6 Finanzverfassungsrechtliche Bestimmungen 298
6.7 Kreditwesenrecht 298
6.8 Zwischenergebnis 299
7 Verpflichtung zur Daseinsvorsorge 299
7.1 Verpflichtung der Verwaltung 300
7.2 Verantwortung der Regierung 300
7.3 Bindung des Gesetzgebers 301
7.4 Verpfl ichtung der Rechtsprechung 302
7.5 Verantwortung Privater? 303
7.6 Zwischenergebnis 306
8 Kompetenzen zur Daseinsvorsorge 307
8.1 Regelungskompetenz 307
8.2 Organisationskompetenz 311
8.3 Handlungsformenkompetenz 313
8.4 Finanzierungskompetenz 313
8.5 Zwischenergebnis 316
9 Daseinsvorsorge im Spektrum kommunaler Aufgaben 316
9.1 Einteilung nach der Herkunft der Aufgabe 317
9.2 Einteilung nach dem Eingriff in die Bürgersphäre 320
9.3 Zwischenergebnis 321
10 Verhältnis der Verpfl ichtung zur Daseinsvorsorge zurpolitischen Aushandlung kommunaler Aufgaben 321
10.1 Kommunale Organe 322
10.2 Beteiligung der Einwohner 327
10.3 Kommunalaufsichtsbehörde 330
10.4 Zwischenergebnis 331
11 Verhältnis der Daseinsvorsorge zu Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 332
11.1 Spannungsfeld auf Ebene des europäischen Primärrechts 332
11.2 Verwendung des Begriffs der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im europäischen Primärrecht 334
11.3 Verhältnis der Daseinsvorsorge zu Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 336
11.4 Zwischenergebnis 338
Abkürzungsverzeichnis 339
Literaturverzeichnis 340
7 Zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland und Europa 342
1 Indikatoren für zivilgesellschaftliches Engagement im European Social Survey (ESS) 342
1.1 Datengrundlage: Der European Social Survey 342
1.2 Begriff des zivilgesellschaftlichen Engagements 343
1.3 Indikatoren für zivilgesellschaftliches Engagement im ESS 345
1.4 Formen der Darstellung und methodische Aufbereitung 353
2 Trendbeschreibungen: Entwicklungen von 2002 bis 2012 in Deutschland und Europa 356
2.1 Zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland 2002 bis 2012 356
2.2 Trends in Europa und in ausgewählten europäischen Ländern 366
3 Mikroanalysen 377
3.1 Definition und Messung der unabhängigen (erklärenden) Variablen 378
3.2 Abhängigkeiten: Schrittweise Regressionen 380
3.3 Strukturmodell „zivilgesellschaftliches Engagement“ 392
4 Makroanalysen 396
4.1 Zivilgesellschaftliches Engagement als Strukturmerkmal von Ländern: „Sozialkapital“ 396
4.2 Erklärung von zivilgesellschaftlichem Engagement als soziale Struktur durch andere soziale Strukturen 399
5 Zusammenfassung und Schlussbetrachtung: Wichtige Ergebnisse und Anforderungen an künftige Forschungen 411
5.1 Zusammenfassung: Das Wichtigste in Kürze 411
5.2 Schlusskommentar: Was sollte in künftigen Forschungen stärkere Beachtung finden? 418
Literaturverzeichnis 423
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 425
8 Migration und Engagement 428
1 Migration und demografischer Wandel: Daten und Fakten 428
2 Engagement von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 432
2.1 Zum Begriff und Verständnis von Engagement 434
2.2 Allgemeiner Forschungsstand 435
3 Religiöses Engagement in Spannungsfeldern und zivilgesellschaftliche Bezüge 450
3.1 Herausforderungen und Perspektiven 454
4 Sozialstrukturelle und weitere Faktoren als engagementrelevante Voraussetzungen 456
5 Engagementförderung und Schule: Potenziale und Erfordernisse 460
6 Freiwilligendienste als Lern-, Orientierungs- und Bildungsdienste: Selektionseff ekte und relevante Maßnahmen 464
7 Politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 467
8 Migrantenorganisationen 472
8.1 Heterogenität und Ausrichtungen 472
8.2 Rollenzuweisungen und Funktionen 473
8.3 Engagement in Spannungsfeldern: „bridging“ versus„ bonding social capital“ 474
8.4 Interkulturelle Öffnung und Kooperationen 477
8.5 Die metakommunikative Ebene: Semantische Sensibilisierung 481
9 Diskursfeld Islam: Öff entliche, Fremd- und Selbstbilder und ihre Implikationen 482
9.1 Die einflussreiche Rolle der Medien 483
9.2 Diskriminierung und gesellschaftliche Fehlplatzierungen: Negative Effekte und Gegenmaßnahmen 485
10 Integrationspolitik und Engagementpolitik 496
10.1 Bürgerschaftliches Engagement von Personen mit Migrationshintergrund in bundespolitischen Integrationsplänen 497
10.2 Engagementstrategien von Bund und Ländern 503
Literaturverzeichnis 507
9 Flüchtlinge und Engagement 516
1 Eine große Herausforderung und die Grenzen des Beitrags der Zweiten Engagementberichts kommission 516
2 Vielfalt des Engagements in den kontroversen Haltungen und Aktionen zur Flüchtlingsfrage 521
3 Der zentrale Bereich gegenwärtigen Engagements: Praktische Hilfe und Unterstützung in der Flüchtlingsarbeit 525
4 Trends und innovative Entwicklungen im Bereich des Engagements in der Flüchtlingshilfe 532
5 Kooperatives Regieren und Verwalten – Nicht nur bei den Aufgaben humanitärer Hilfe, sondern auch im Umgang mit den Herausforderungen der Flüchtlingsfrage 536
6 Die Einbeziehung örtlicher staatlicher Einrichtungen und verschiedener Politikfelder 541
7 Zusammenfassung und Perspektiven 544
Literaturverzeichnis 547
10 Verantwortung und Identität vor Ort 550
1 Hintergrund 550
2 Lokale Dialogforen im Rahmen der Arbeit am Zweiten Engagementbericht 552
2.1 Ziele und Anliegen 552
2.2 Methodisches Vorgehen 553
2.3 Charakterisierung der ausgewählten Orte 554
2.4 Ergebnisse 557
2.5 Die Bedeutung regionaler Unterschiede 566
3 Einfl ussfaktoren für Engagement vor Ort 567
Literaturverzeichnis 570
11 Die Engagementberichterstattung der Bundesregierung 571
Autorinnen und Autoren 579
| Erscheint lt. Verlag | 21.11.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Bürgergesellschaft und Demokratie |
| Zusatzinfo | VI, 580 S. 54 Abb., 38 Abb. in Farbe. |
| Verlagsort | Wiesbaden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Staat / Verwaltung |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Bürgerkommune • Bildung • Bürgerkommune • Daseinsvorsorge • Europa • German Politics • Integration • Migration |
| ISBN-10 | 3-658-18474-4 / 3658184744 |
| ISBN-13 | 978-3-658-18474-2 / 9783658184742 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 10,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich