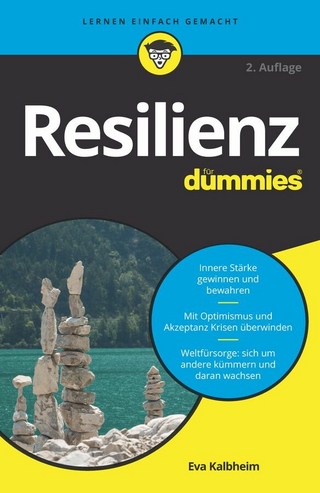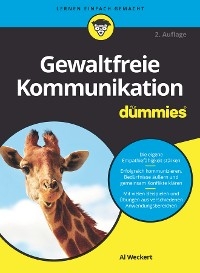Überwintern. Wenn das Leben innehält (eBook)

272 Seiten
Insel Verlag
978-3-458-77072-5 (ISBN)
Es gibt Zeiten, da liegt unser Leben 'auf Eis' und wir fühlen uns wie aus der Welt gefallen. Durch eine Krankheit oder den Verlust eines geliebten Menschen, durch Arbeitslosigkeit. Auch ein freudiges Ereignis wie die Geburt eines Kindes kann uns aus dem Gleichgewicht bringen. Katherine May nennt diese Zeiten des Rückzugs, die ihr selbst nur allzu vertraut sind, »Winter«. Und wie auch in der winterlichen Kälte alles ruht, um Kraft für den Frühling zu sammeln, so gibt May sich dem 'Überwintern' hin. Sie reist nach Tromsø zu den Polarlichtern, schwimmt im eisigen Meer, schwitzt in der Sauna und feiert das Winterfest Santa Lucia. Sie besinnt sich auf das Wesentliche und gibt sich der Ruhe und inneren Einkehr hin - bis sie sich wieder bereit fühlt, mit neuer Energie weiterzumachen.
Wir können uns unsere Winter nicht aussuchen. Aber wie wir überwintern, schon. Ein wunderbares Buch über die heilsame Kraft des Innehaltens.Katherine May schreibt Romane und Sachbücher, u. a. über Autismus. Sie verfasste zahlreiche Artikel für u. a. die <em>Times </em>und unterrichtete Creative Writing an der Christ Church University in Canterbury. Sie lebt am Meer im englischen Whitstable und liebt es, draußen zu sein. Mays Bücher erscheinen in 26 Sprachen. Ihr Buch <em>Überwintern. Wenn das Leben innehält </em>war ein internationaler Erfolg und stand monatelang auf der <em>Spiegel</em>-Bestsellerliste.
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 06/2023) — Platz 18
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 04/2023) — Platz 20
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 03/2023) — Platz 16
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 02/2023) — Platz 16
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 01/2023) — Platz 14
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 52/2022) — Platz 11
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 51/2022) — Platz 14
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 50/2022) — Platz 14
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 49/2022) — Platz 14
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 48/2022) — Platz 15
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 47/2022) — Platz 13
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 46/2022) — Platz 11
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 45/2022) — Platz 11
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 44/2022) — Platz 15
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 43/2022) — Platz 12
Spätsommer
Manche Winter beginnen mit Sonnenschein. Dieser begann an einem strahlenden Tag Anfang September, eine Woche vor meinem vierzigsten Geburtstag.
Ich feierte mit ein paar Freunden am Strand von Folkestone, der in den Ärmelkanal ragt, als strecke er die Hand aus nach Frankreich. Um eine richtige, große Party zu vermeiden, mir aber dennoch den Übergang in das nächste Lebensjahrzehnt zu erleichtern, hatte ich für die kommenden zwei Wochen mehrere Abende geplant, an denen ich mit diversen Freunden gut essen und trinken wollte, und dieser war der erste. Die Fotos von jenem Tag kommen mir heute absurd vor. Wie berauscht von meinem Älterwerden knipste ich den in das warme Licht des Spätsommers getauchten Küstenort. Den Waschsalon, an dem wir auf dem Weg vom Parkplatz vorbeikamen und der wie aus der Zeit gefallen wirkte. Die den Strand säumenden, pastellfarbenen Betonhütten. Unseren zusammengewürfelten Haufen Kinder, wie sie über den Wassersaum sprangen und im unfassbaren Türkis des Meeres planschten. Den Becher Gypsy-Tart-Eis, den ich mir genehmigte, während die Kinder spielten.
Von meinem Mann, H, gibt es keine Fotos. Das ist erst mal nichts Ungewöhnliches: Ich habe zig Fotos von meinem Sohn Bert und dem Meer gemacht. Ungewöhnlich ist die dann folgende Lücke in meinem Fotoordner. Das nächste Bild ist zwei Tage später aufgenommen und zeigt H, wie er im Krankenhaus liegt. Für die Kamera ringt er sich ein gequältes Lächeln ab.
H hatte bereits am Strand über Bauchschmerzen und Übelkeit geklagt. Ich maß dem nicht viel Bedeutung bei, schließlich schleppt so ein Kleinkind wie Bert in einem fort irgendwelche Keime ins Haus, von denen man Halsschmerzen, Ausschlag, eine verstopfte Nase oder eben Bauchweh bekommt. Und H hat auch kein großes Aufheben gemacht. Nach dem Mittagessen, das er nicht angerührt hatte, marschierten wir die Steilküste hinauf zum Spielplatz. H verschwand für ein paar Minuten. Ich fotografierte Bert, wie er im Sandkasten spielte, er hatte sich einen Schweif aus Meertang hinten in den Hosenbund gesteckt. Als H wiederkam, sagte er, er habe sich übergeben.
»O nein!«, sagte ich und versuchte dabei mitfühlend zu klingen, während ich gleichzeitig dachte, wie ungelegen mir das kam. Jetzt mussten wir den Ausflug sicher abbrechen, damit er sich zu Hause hinlegen konnte. Er hielt sich den Bauch, aber das fand ich unter den gegebenen Umständen nicht weiter beunruhigend. Ich hatte keinerlei Eile, den Rückweg anzutreten, und das muss ziemlich deutlich gewesen sein, denn unser Freund – einer unserer ältesten Freunde, ein Schulfreund – tippte mir auf die Schulter und sagte: »Katherine, ich glaube, H geht es wirklich nicht gut.«
»Ach ja?«, sagte ich. »Glaubst du?« Ich sah zu H, dessen schmerzverzerrtes Gesicht schweißnass glänzte. Ich sagte, ich würde das Auto holen. Ich kann mich noch gut an den Schrecken erinnern, den ich in jenen Minuten empfand.
Als wir nach Hause kamen, glaubte ich immer noch nicht daran, dass wir es mit etwas Schlimmerem als dem Norovirus zu tun hatten. H legte sich ins Bett, und ich versuchte, Bert zu beschäftigen, der ja nun um seinen Nachmittag am Strand gebracht worden war. Zwei Stunden später rief H nach mir, und als ich nach oben ins Schlafzimmer kam, war er dabei, sich anzuziehen. »Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus«, sagte er. Ich lachte überrascht auf.
Mit einer Kanüle im Handrücken saß H auf einem der Plastikstühle im Wartezimmer und sah hundeelend aus. Es war Samstagabend. In der Notaufnahme wimmelte es von Rugbyspielern, die ihre gebrochenen Finger bewunderten, Bierleichen mit lädierten Visagen und alten Menschen in Rollstühlen, deren Betreuer sich weigerten, sie zurück ins Seniorenheim zu bringen. Ich hatte Bert bei den Nachbarn abgegeben und versprochen, ihn in ein bis zwei Stunden wieder abzuholen, aber es dauerte nicht lange, bis ich eine Nachricht schrieb und fragte, ob er bei ihnen übernachten könne. Es war bereits nach Mitternacht, als ich H schließlich im Krankenhaus alleine ließ, und da hatte man ihn immer noch nicht auf eine Station gebracht.
Ich fuhr nach Hause und machte kein Auge zu. Als ich am nächsten Morgen wieder ins Krankenhaus kam, ging es H deutlich schlechter. Er war sehr matt und fiebrig. Die Schmerzen hätten im Laufe der Nacht zugenommen, erzählte er, doch gerade als er meinte sie nicht mehr aushalten zu können, sei Schichtwechsel gewesen, und keine der Krankenschwestern konnte ihm Medikamente zur Linderung geben. Dann sei sein Blinddarm geplatzt. Er hätte das gespürt. Er habe vor Schmerzen gebrüllt und sei von der Stationsschwester angegangen worden, er könne sich wohl nicht benehmen und würde furchtbar übertreiben. Der Mann im Nachbarbett sei aufgestanden und habe sich für ihn eingesetzt. Durch den Vorhang rief der Nachbar uns zu: »Dabei war ihm doch anzusehen, wie schlecht es ihm ging, dem armen Kerl.«
Aber von einer Operation war offenbar immer noch keine Rede. H hatte Angst.
Und dann bekam auch ich Angst. Ganz offensichtlich war während meiner Abwesenheit etwas sehr Gefährliches und Schreckliches passiert, doch es kümmerte keinen: Die Pflegerinnen und Ärzte bewegten sich mit einer Seelenruhe durch die Station, als bestünde keinerlei Eile – als solle jemand, dem ein inneres Organ platzt, sich bitte einfach entspannen und das klaglos hinnehmen. Schlagartig und sehr heftig wurde mir bewusst, dass ich H verlieren könnte. Er brauchte jemanden an seiner Seite, der für ihn kämpfte. Also blieb ich bei ihm, ohne mich um die Besuchszeiten zu scheren, und wenn seine Schmerzen unerträglich wurden, lief ich der Stationsschwester hinterher, bis sie ihm half. Normalerweise bringe ich es nicht mal fertig, mir eine Pizza zu bestellen, aber das hier war etwas anderes. Das hier war ich gegen sie, das Elend meines Mannes gegen ihre starren Routinen. Ich würde mich nicht geschlagen geben.
Um neun Uhr abends ging ich an dem Sonntag nach Hause und rief stündlich im Krankenhaus an, bis H endlich im OP war. Sollten sie mich doch für hysterisch und nervig halten. Dann lag ich wach, bis mein Mann wieder raus war aus dem OP und man mir sagte, es gehe ihm gut. Trotzdem konnte ich nicht schlafen. Es gibt Situationen, in denen schlafen sich für einen anfühlt wie fallen: Erst versinkt man in köstlicher Finsternis, und dann fährt man auf einmal hoch und sieht sich suchend in der Dunkelheit um. Doch alles, was ich in jener Zeit fand, waren meine eigenen Ängste: davor, dass mein Mann unerträglich leidet; davor, dass ich ihn verlieren könnte und dann alleine weiterleben, überleben müsste.
Die ganze Woche hielt ich an seinem Krankenbett Wache, während Bert in der Schule war. Ich war da, als der Chirurg fast schon ehrfürchtig vom Entzündungszustand berichtete; ich war da, um mit wachsender Sorge zu beobachten, dass Hs Temperatur nicht sinken wollte und sein Blutsauerstoff sich nicht normalisierte. Ich half H dabei, kleine Spaziergänge auf der Station zu unternehmen, und sah ihm hinterher beim Schlafen zu. Manchmal nickte er mitten im Satz ein. Ich zog ihm saubere Sachen an und reichte ihm winzige Portionen zu essen. Ich versuchte, Bert zu beruhigen, der Angst um seinen Vater hatte, weil der an so vielen Schläuchen und Kabeln und piepsenden Geräten hing.
Irgendwo inmitten dieser Katastrophe tat sich etwas in mir auf, wie ein Riss. Ich verbrachte so viele Stunden im Auto auf dem Weg zum Krankenhaus und zurück; ich saß an Hs Bett, während er schlief; wartete in der Cafeteria, bis die Visite abgeschlossen war. Ich stand unter enormer Anspannung und war gleichzeitig dazu verdammt, ruhig zu bleiben. Die ganze Zeit musste ich anwesend und in Alarmbereitschaft sein – aber gleichzeitig war ich ein zum Nichtstun verdammter, überflüssiger Eindringling. Ich verbrachte Ewigkeiten damit, Löcher in die Luft zu starren und mich zu fragen, was ich tun sollte, während gleichzeitig alles in mir daran arbeitete, diese völlig neuen Erfahrungen irgendwie zu sortieren und in einen Zusammenhang zu bringen.
Und je tiefer dieser Riss ging, desto...
| Erscheint lt. Verlag | 1.11.2021 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Wintering. How I learned to flourish in difficult times |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Lebenshilfe / Lebensführung |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik | |
| Schlagworte | aktuelles Buch • Auftanken • Auszeit • Bestseller bücher • buch bestseller • bücher neuerscheinungen • Burnout • Depression • Der Salzpfad • erling kagge • Geschenk Freundin • Geschenk für Kranke • innere Heimat • Inneres Gleichgewicht • insel taschenbuch 4943 • IT 4943 • IT4943 • Lebensfreude • Lektüre Lockdown • Midlifecrisis • Neuerscheinungen • neues Buch • Raynor Winn • Selbstfürsorge • Selbstwirksamkeit • Spiegel-Bestseller-Liste • Winter |
| ISBN-10 | 3-458-77072-0 / 3458770720 |
| ISBN-13 | 978-3-458-77072-5 / 9783458770725 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich