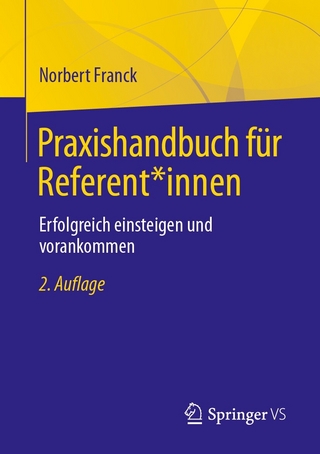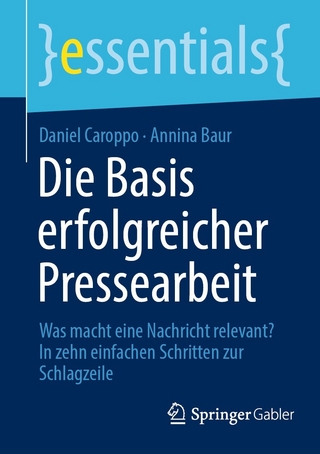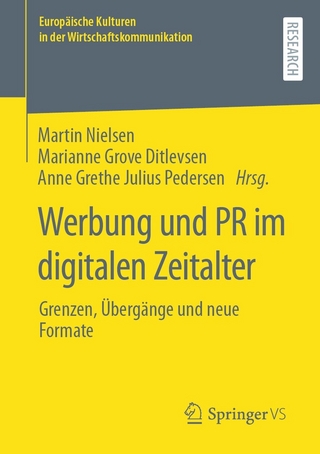Medien - Demokratie - Bildung (eBook)
XV, 346 Seiten
Springer VS (Verlag)
978-3-658-36446-5 (ISBN)
Prof. Dr. Gudrun Marci-Boehncke lehrt Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dortmund und ist Leiterin der Forschungsstelle Jugend - Medien - Bildung.
Vorwort 6
Inhaltsverzeichnis 9
Herausgeber*innen- und Autor*innenverzeichnis 12
Über die Herausgeber*innen 12
Autor*innenverzeichnis 12
Information: Medien und Demokratie 25
2 Transmedia, Speculative World-Building and the Civic Imagination 26
References 36
3 Ermächtigungsmaschinen. Ein Essay. 38
Literatur 41
4 Die Ko-Regulierung Algorithmen-basierter Plattformunternehmen als institutionentheoretische Frage 42
1 Einige Gedanken zur Ökonomie und Ethik digitaler Plattformen 42
2 Institutionenökonomische Überlegungen am Beispiel der Open Data: Governance-Lösungen 45
2.1 Institutionenökonomische Analyse von Open Data 45
2.2 Governance-Lösungen 49
3 Operationalisierung der Verantwortung: grundlegende institutionenethische Möglichkeiten 52
4 Fazit und Ausblick: Governance mittels Ko-Regulierung 55
Literatur 56
5 Regulierung von Internet-Inhalten: Ombudsstellen als Governance-Option an der Schnittstelle von Recht und Ethik 59
1 Einleitung 59
2 Inhaltsregulierung durch die Plattformbetreiber 61
2.1 Gemeinschaftsrichtlinien (community standards) 61
2.2 Inhaltsregulierung (content moderation) 62
2.3 Einspruchsmöglichkeiten 64
3 Staatliche Inhaltsregulierung 65
4 Nationale Ombudsstellen als Governance-Option 66
4.1 Ausgewählte Vorteile von nationalen Ombudsstellen 67
4.2 Institutionelle Ausgestaltung 69
4.3 Rolle nationaler Ombudsstellen in aktuellen Regulierungsinitiativen 70
5 Fazit 71
Literatur 73
6 Schulbezogene Meldeplattformen als Prototypen medialer Normalitätsverschiebung – Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung und Lehramtsausbildung im Fach Deutsch 76
1 Einleitung 76
2 Die Webseite lehrersos.de als Mittel medialer Normalitätsverschiebung 79
2.1 Allgemeiner Aufbau der Webseite 82
2.2 Bildsprachliche Symbolik 83
2.3 Ankerbeispiele: Kulturalisierung und Opfermythos 84
2.4 Umgang mit Zitaten 85
2.5 Umgang mit Rechtsvorschriften 86
3 Konsequenzen für den Deutschunterricht 87
3.1 Perspektive 1: Sprachliche Schlüsselkompetenzen für demokratische Partizipation 88
3.2 Perspektive 2: Die politische Kampagne aus medienethischer Perspektive 91
4 Konsequenzen für die Lehramtsausbildung im Fach Deutsch 93
5 Fazit 97
Literatur 98
Partizipation: Digitale Bildung auf allen Ebenen der Gesellschaft 103
7 Paradoxien virtueller Partizipation. Sondierungen im Spannungsfeld ko-kreativer Gestaltung von freien Bildungsmedien und globaler Bildungsindustrie 104
1 Einleitung 104
2 Freie Bildungsmedien und die globale Bildungsindustrie 107
3 Paradoxien virtueller Partizipation – Reflexionen und Sondierungen 110
4 Thesen zur weiteren Diskussion 116
5 Fazit 119
Literatur 120
8 Medienkompetenz als Herausforderung für Demokratie und politische Bildung 125
1 Medienkompetenz als Herausforderung für die Demokratie: Zum digitalen Strukturwandel der demokratischen Öffentlichkeit 125
2 Medienkompetenz als Ziel politischer Bildung – von der Mediendemokratie bis zur Digitaldemokratie 130
3 Nachrichtenquellen und Medienvertrauen bei Jugendlichen 133
4 Zur Förderung der politischen Medienkompetenz und der Rolle von Medienvertrauen und Wissenschaftsverständnis 135
Literatur 138
9 Menü statt à la carte – Warum wir digitale, politische und ethische Bildung gemeinsam denken müssen 142
1 Einleitung 142
2 Status Quo aus medienpädagogischer Forschungsperspektive 144
2.1 Wie steht die Medienpädagogik zu politischer und ethischer Einbindung? 144
2.2 Debatte zu Frameworks Digitaler Kompetenzen 146
3 Trügerisches Bild eines ausreichenden digitalen Lernangebots? 147
3.1 Digitale Kompetenznormen 147
3.2 Digitale Kompetenzen werden oft isoliert und ohne interdisziplinäre Peripherie vermittelt 149
4 Konkrete Ansätze für die medienpädagogische Praxis 151
4.1 Tech-Konzerne und die Macht Sozialer Medien zum Thema machen 151
4.2 Medienlogik, Filterblasen und Echokammern entzaubern 152
4.3 Digital, kreativ und produktiv zum „Produser“ werden 154
5 Fazit – Rahmen gestalten und Potenziale nutzen 154
Literatur 155
10 Digitale Literacy als ‚neue‘ Medienkompetenz mit einer Prise IT-Sicherheit – ein Blick auf den tertiären Bildungssektor am Beispiel der Medienwissenschaft 159
1 Einleitung 159
2 Medienkompetenz im interdisziplinären Diskurs 161
2.1 Begriffsgenese und Diskursfelder 162
2.2 Risiko- und Datenschutzkompetenz 163
2.3 Technologiezentrierte Medienkompetenz als medienpädagogischer Fokus 164
3 Das Wissenskorpus und die Neuausrichtung der Medienanalyse 169
3.1 Das Basiswissen über IT-Sicherheit und die fachspezifische Anforderung für die Medienwissenschaft 169
3.2 Interdisziplinarität als Nutzen für die fachinterne Weiterentwicklung 171
3.3 Meta-Anforderungen für das Wissenskorpus über IT-Sicherheit 171
Literatur 172
11 Ethik-, Medien- und Politikdidaktik im Gespräch – Über den Nutzen der TRAP-Mind-Theory und digitaler Medien für die inklusive politische Bildung 176
1 Einstellungen von Lehrpersonen gegenüber digitalen Medien 176
2 Politische Bildung – ein konkretes Modell 177
3 Die TRAP-Mind-Theory 182
4 Inklusion 187
5 Digitale Medien in der inklusiven politischen Bildung 189
6 Mögliche Einwände und Fazit 191
Literatur 192
12 Funktionen informeller Bildung, Aufklärung und Gemeinschaftsbildung durch Fernsehserien am Beispiel von 13 Reasons Why 195
1 Einleitung 195
2 Mediales Potenzial der Aufklärung über Suizidalität 197
3 Das Aufklärungspotenzial fiktionaler Serien am Beispiel 13 Reasons Why 200
4 Televisuelle Gemeinschaften in einer einsamen modernen Gesellschaft 202
5 Sieben Funktionen der Gemeinschaftsproduktion durch Fernsehserien 204
6 Fazit: Moderne Gesellschaften benötigen zum Zusammenhalt anspruchsvolle Fernsehserien 208
Literatur 209
Reflexion: Disruption und Konvergenz 214
13 Medien – Demokratie – Bildung: Praxisorientierte Überlegungen zur medienethischen Bildung des animal politicum digitalis 215
1 „Produtzung“: Konsequenzen für medienethische Bildung 218
1.1 Informationsbereitstellung und -steuerung in der digitalen Gesellschaft 219
1.2 (Medien-)Ethik als normatives Fundament von Medienbildung 220
2 Medienethische Bildung konkret: Praxisorientierte Überlegungen für die schulische Bildung 221
2.1 Kompetenzerwartungen an Lernende – Kompetenzanforderungen für Lehrende 222
2.2 Medienethische Materialien für den Unterricht: Interaktive Lernbausteine 225
3 Ausblick 228
Literatur 230
14 Überwachung als Norm – Reflexionen zu medienethischer Forschung und Didaktik 233
1 Theoretische Vorbemerkungen 233
2 Digitale (Selbst)Überwachung – ein Lehr-Forschungsprojekt 235
3 Forschungsergebnisse im Überblick 238
3.1 Freiwillige Datenfreigabe 238
3.2 Vor- und Nachteile von Überwachung 240
3.3 Haltungen gegenüber Überwachung 241
3.4 Das Gefühl der Überwachung 242
3.5 Self-Tracking: Motive, Ziele und Zwecke von Selbstüberwachung 243
3.6 Vor- und Nachteile von Selbstüberwachung 243
4 Überwachung als Norm 244
5 Zur Integration medienethischer Forschung, Theoriebildung und Didaktik mit dem Ziel der Reflexion 247
Literatur 250
15 Demokratie 2.0 – Rawls’ und Nussbaums Gerechtigkeitstheorien im Kontext der digitalen Öffentlichkeit 253
1 Forschungshintergrund: Das global schwindende Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik 253
2 Die Gesellschaft im Wandel: Prädigitale und digitale Demokratie im Vergleich 255
2.1 Wer schafft wie politische Öffentlichkeit? Die Überwindung der Selektionsnormen 255
2.2 Partizipationsmöglichkeiten: Alle Augen auf das Individuum 257
2.3 Politische Prozesse: Beschleunigung und Vereinfachung 258
2.4 Garantie der Grundrechte: Die Menschenwürde in Gefahr 259
2.5 Verständnis von Identität und Privatsphäre: Die digitale Bühne der Selbstinszenierung 260
2.6 Wege der politischen Bildung Jugendlicher: Manipulation der angehenden Erwachsenen 261
3 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Demokratie: Das bürgerliche Individuum im Zentrum des politischen Geschehens 262
3.1 Neue Forderungen und Fragestellungen an Recht und Ethik 262
3.2 Die Verantwortung der einzelnen Person: Plädoyer für eine Verantwortungsethik der digitalen Demokratie 265
3.3 Von der Notwendigkeit der Vermittlung einer Medienkompetenz 267
4 Fazit und Ausblick 270
Literatur 271
16 Zwischen „Hate Speech” und „Cancel Culture”: eine medienethische Betrachtung aktueller Debatten um Meinungs- und Redefreiheit im Internetzeitalter 274
Literatur 292
17 Mediale Hasssprache und technologische Entscheidbarkeit: Zur ethischen Bedeutung subjektiv-perzeptiver Datenannotationen in der Hate Speech Detection 295
1 Einleitung 296
2 Annäherungsversuche an eine Definition 296
3 Technologische Methodik zur Detektion von Hate Speech 298
4 Ethische Grundfragen zum Konzept Hate Speech 300
5 Methodische Kritik und Lösungsansätze der technologischen Hate Speech Detection 302
6 Perspektiven zur begrifflichen Umsetzung von Annotationen in der Hate Speech Detection 305
7 Zusammenfassung 307
Literatur 308
18 Digitale Demokratie – sind moralisch kompetente Maschinen Träger eigener Rechte? 311
1 Einleitung 312
2 Moralität und Personalität 314
3 Der Turing-Test als Entanthropologisierungsverfahren 315
4 Der Rechtspositivimus als eine speziesismusneutrale Rechtstheorie 316
5 Historischer Exkurs: Der Rechtspositivismus als Faschismus-Exkulpation 317
6 Normtheoretischer Rechtspositivmus – Hans Kelsen revisited 318
7 Fingierte Grundnorm und die Freiheit von moral machines 320
8 Fazit: Kelsens Grundnorm als Begründung eines nicht-anthropozentrischen Person-Status 322
Literatur 323
19 EscapeRoom.EchoChamber – Möglichkeiten und Grenzen digital-theatraler Online-Partizipation 326
1 Theoretischer Hintergrund 328
1.1 Online-Kommunikation und Partizipation – zwischen Inklusion und Exklusion 328
1.2 Digitales postdramatisches Theater im Verhältnis zur aktuellen Gesellschaft 329
2 Praxis 333
2.1 Postdramatisches Theater in der Praxis 333
2.2 Theater mit Medien, Demokratie und Bildung 334
2.3 Digitaler Inhalt – digitale Form 336
2.4 Prozess und Produkt 337
2.5 Theaterpädagogik und Medienbildung 339
3 Fazit 340
Literatur 342
| Erscheint lt. Verlag | 4.4.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Ethik in mediatisierten Welten |
| Zusatzinfo | XV, 347 S. 12 Abb., 9 Abb. in Farbe. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Kommunikation / Medien ► Kommunikationswissenschaft |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Demokratiebildung • Digital Literacy • Mediatisierung • Medienbildung • Medienethik • Politische Bildung |
| ISBN-10 | 3-658-36446-7 / 3658364467 |
| ISBN-13 | 978-3-658-36446-5 / 9783658364465 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich