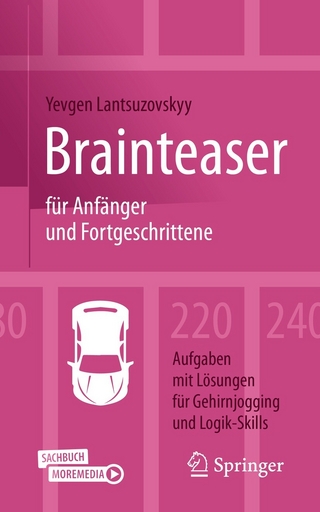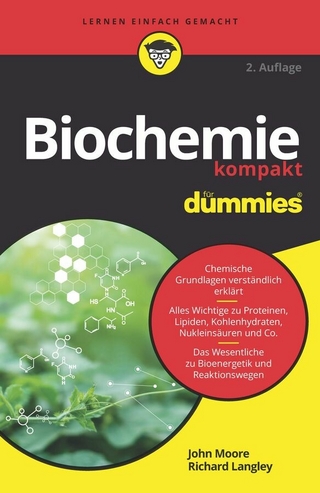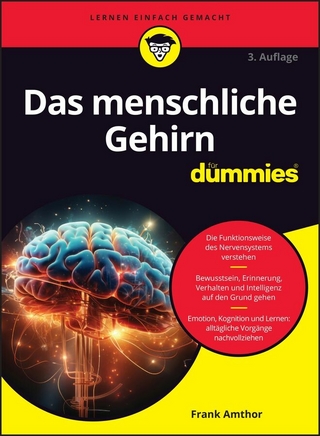Regenwälder (eBook)
288 Seiten
Aufbau digital (Verlag)
978-3-8412-2688-4 (ISBN)
Josef H. Reichholf, 1945 in Niederbayern geboren, war bis Mai 2010 Leiter der Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung München und Professor für Ökologie und Naturschutz an der TU München. 2007 wurde er mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet. 2010 erhielt sein Bestseller 'Rabenschwarze Intelligenz' den Preis 'Wissenschaftsbuch des Jahres'. Zuletzt erschienen von ihm 2017 in den 'Naturkunden' der als 'Wissensbuch des Jahres' ausgezeichnete Band 'Symbiosen' 'Das Leben der Eichhörnchen' (2019) und 'Der Hund und sein Mensch'.
Menschliches Leben im Regenwald
Die amazonischen Indios waren zwar überwiegend Jäger und Sammler, bevor sie Kontakt mit den Europäern bekamen, und insbesondere jene Stämme, die sich in die Tiefen der Wälder zurückzogen, blieben dies, bis sie von Missionaren, Gummisammlern, Goldsuchern und Siedlern schließlich doch erreicht wurden. Aber neuere Untersuchungen haben ergeben, dass entlang des Amazonas bereits vor Jahrtausenden ziemlich umfangreich Ackerbau betrieben worden war. Schichten von sogenannter schwarzer Erde (terra preta) beweisen dies. Dennoch kann von einer großflächigen Kultivierung keine Rede sein. Denn wenn auch die Überschwemmungen des Amazonas nicht in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden der jüngeren Vergangenheit das gleiche Ausmaß erreicht haben dürften, weil es global feuchtere und trockenere Perioden gegeben hatte, so war am Amazonas keinesfalls eine Flussoasenkultur wie am Nil möglich gewesen.
Die Funde von terra preta decken sich weitgehend mit dem Gebiet, das zur várzea gehört, also vom Weißwasser regelmäßig mit frischen Nährstoffen gedüngt wird. Insofern liegen die früheren Schätzungen zur Häufigkeit der Indios in Amazonien wahrscheinlich zu niedrig. Aber von einer dichten Besiedlung wie am Nil bleiben auch die nachgebesserten Werte zur Siedlungsdichte weit entfernt. Umrechnungen auf Menschen pro Quadratkilometer ergeben ohnehin wenig Sinn, wenn die Siedlungen sehr lokal an den Flussufern liegen und das weite Hinterland der terra firme-Wälder nur als gelegentliches Streifgebiet oder jahrzehntelang gar nicht genutzt wird. Die Verhältnisse entsprechen jenen in den großen Wüsten, wo sich die Bevölkerung auf die Oasen und bestimmte Täler oder Gebirgsstöcke konzentriert. Durchziehende Karawanen blieben ephemer und für die Weiten der Wüste bedeutungslos. So etwa können wir uns die Verhältnisse in Amazonien als Großraum vorstellen.
So ein Großbild setzt sich aber aus einer Vielzahl kleiner Siedlungen zusammen, die nicht nur an den Flüssen liegen. Manche, insbesondere in den Randgebieten, wo der geschlossene Regenwald in savannenartige Landschaften übergeht, repräsentieren das seit Langem bekannte Muster des Wanderfeldbaus. Kleine Flächen, oft weniger als einen Hektar groß, werden dabei gerodet und zu Pflanzungen umgewandelt. Eigentlich waren es Gartenkulturen, keine Felder im üblichen Wortsinn. Zudem hatte es vor Eintreffen der Europäer die gegenwärtig so wichtigen, weil anspruchslosen und rasch wachsenden Bananen, die keiner weiteren Bearbeitung bedürfen, in Amazonien nicht gegeben. Die wichtigste, möglicherweise an der Peripherie Amazoniens als Kulturform entstandene Nutzpflanze ist Maniok (Manihot utilissima). Es lohnt, sie hervorzuheben, weil ihre Bedeutung sehr groß und ihr Zustandekommen als Hauptquelle pflanzlicher Stärke höchst verwunderlich ist. Auch kleine Palmen wurden auf diesen Mini-Rodungen kultiviert. Da sie nicht schon nach wenigen Jahren nutzbare Palmfrüchte liefern, mussten die Indios die Pflanzplätze erst einige Jahre pflegen und sich die Orte genau einprägen, um sie nach Jahren wiederfinden zu können, wenn die Bäume alt genug zum Fruchten waren. Mit Mais ging das Pflanzen verhältnismäßig einfach, aber die Erträge blieben gering, weil Mais bessere Böden zum Wachsen benötigt, als sie in Amazonien vorhanden sind, und mangels eigener Schutzstoffe (Giftigkeit) viele tierische Nutzer (Schädlinge) anzieht.
Diese Hinweise mögen genügen, um anzudeuten, dass die Indios nicht einfach ein Stück Land roden und darauf pflanzen konnten, was sie wollten oder benötigten. Auf mageren Böden ist kein üppiges Wachstum möglich. Und vor allem kein dauerhaftes. Das Wechseln zu neuen, frisch gerodeten Flächen musste alle Jahre oder alle paar Jahre stattfinden, weil die einzelnen Flächen zu schnell ihre geringe Fruchtbarkeit einbüßten. Nur im ersten, vielleicht noch im zweiten Jahr sah es ganz gut aus.
Die Kulturen profitierten von der Art, wie die gerodete Fläche behandelt worden war. Man hatte nicht einfach den Wald entfernt, sondern diesen im Wesentlichen gefällt und dann abgebrannt. Die größeren und großen Stämme blieben liegen. Für sie hätte es ohnehin keine andere Verwendung gegeben. Als Baumaterial wurde lediglich benötigt, was sich als Stütze für die Hütten eignete. Gedeckt wurden diese mit Schichten aus Palmwedeln. Für die Feuer brauchte man Kleinholz. Bevor die Indios Äxte oder dann im 20. Jahrhundert auch benzinbetriebene Kettensägen bekamen, war das Fällen großer Bäume so gut wie unmöglich. Das Holz vieler ist so hart, dass Steinwerkzeuge nichts ausrichten können, außer ringförmig die Rinde einzukerben, was zum Tod des Baumes führt. Es ist voller Einlagerungen, wie Kieselsäure, dass es treffend als Eisenholz oder Axtbrecher bezeichnet und als tropisches Hartholz in außertropischen Regionen hochgeschätzt wird. Mit dem Abbrennen der gar nicht wirklich gerodeten, sondern brennbar gemachten Fläche wurden die in der Vegetation gespeicherten Mineralstoffe als Asche freigesetzt. Sie lieferte die Anfangsdüngung für die Pflanzungen auf der Kultivierungsfläche.
Blenden wir kurz zurück zur ökologischen Grundstruktur des tropischen Regenwaldes. Die von den Bäumen monopolisierten Nährstoffe liegen in ihren Stämmen fest. Der Boden enthält sehr wenig davon, und Humus gibt es kaum. Ziel der Nutzung musste es für die Indios daher sein, diese gespeicherten Mineralstoffe freizusetzen. Auf das Verrotten von Hartholz konnten sie nicht warten. Das hätte viel zu lange gedauert. Die einzige Möglichkeit war das schonende Verbrennen, das möglichst wenig Flugasche erzeugte und viel Material halbverkohlt zurückließ. Aus diesem wuschen die Regenfälle nach und nach die Mineralstoffe aus. Gepflanzt wurde mit Grabstock per Hand. Die Kultur sah dementsprechend nicht sonderlich kultiviert aus, erwies sich aber als den Umständen angepasste Nutzungsform. Denn da der Boden nicht flächig bloßgelegt worden war, laugten die Starkregen die Aschen auch nicht gleich aus. Die Herausforderung bestand darin, die Kulturen so zu gestalten, dass das in Jahrzehnten Gespeicherte für ein paar Jahre nutzbar blieb. Zwangsläufig bedeutete dies einen Wechsel der Rodungsflächen in kurzen Zeitabständen. Wanderfeldbau also. Keine Dauerkulturen. Zu bekräftigen ist nochmals, dass die Nutzung für etwa ein Zehntel der Zeitspanne möglich ist, die der Wald zu seiner Entwicklung nötig hatte. Oder ein Hundertstel, wenn es sich um Wald auf extrem magerem Boden handelte. Zwei oder drei Jahrhunderte Waldwachstum gingen an solchen Stellen den zwei oder drei Jahren der Nutzung als Pflanzgebiet voraus.
An dieser Stelle ist es angebracht, auf eine höchst bedeutsame Folge der so beeindruckenden Geschlossenheit der ökologischen Kreisläufe im tropischen Regenwald hinzuweisen: Ein solches System erzeugt keine nutzbaren Überschüsse. Je mehr sich ein ökologisches System dem Gleichgewichtszustand nähert, desto geringer werden die Überschüsse. Landwirtschaft funktioniert nur, auch in der Folgenutzung von Tropenwäldern, wenn sie hohe Ungleichgewichte erzeugt.
Das System des Wanderfeldbaus bleibt dem Kreislaufgeschehen im Regenwald nahe, bricht es aber dennoch auf, indem der Speicher, den der Wald darstellt, kurzfristig mit Feuer geöffnet und für rasches Pflanzenwachstum verfügbar gemacht wird. Dafür eignen sich am besten Pflanzen, die entsprechend schnell wachsen und keine besonderen Ansprüche an Boden und Kleinklima stellen. Sie müssen hohe Sonneneinstrahlung aushalten, Starkregen vertragen und auch für einige Zeit Trockenheit oder Überflutungen widerstehen. Solche Pflanzen unterscheiden sich sehr stark von den typischen Regenwaldarten, insbesondere von den Bäumen. Denn diese wachsen langsam, daher ihr sehr hartes Holz, blühen und fruchten selten und entwickeln die unterschiedlichsten Gifte, die sie vor Tierfraß schützen. Fehlen solche, wie in vielen Nutzpflanzen, die der Mensch anbaut, werden sie zum idealen Futter für eine Vielzahl von Tieren, von den Blattschneiderameisen, die mit zerkauten Blättern dieser Kulturpflanzen in unterirdischen Kammern Pilze züchten, bis zu Raupen verschiedenster Schmetterlinge, Larven von Käfern und natürlich zu Affen und Vögeln.
Der kurzzeitigen Behebung des Nährstoffmangels durch die Brandrodung folgten die Armada der tierischen Nutzer in der Pflanzung und natürlich auch die immense Konkurrenz durch andere Pflanzen, die sich die Nährstoffe und das Licht zum Aufwachsen zunutze zu machen versuchen. Und da Wärme und Feuchte in für das Pflanzenwachstum idealer Kombination gegeben sind, stellt die Pflege der Pflanzung einen andauernden Kampf dar. Das Leben im Regenwald war und ist für Menschen kein Zuckerschlecken. Was in die Pflanzung an Zeit und Mühen zu investieren ist, und vor allem von den Frauen geleistet wird, entspricht bei den Männern dem Zeitaufwand für die Jagd. Denn auch Wild ist rar, und zwar aus den gleichen Gründen. Im weitgehend geschlossenen Kreislauf des Wald-Ökosystems fällt für Tiere wenig ab.
Vergegenwärtigen wir uns: Die gesamte tierische Biomasse macht oft nur wenige Prozent der pflanzlichen, der Phytomasse aus (Seite 107). Davon entfällt die Hälfte oder mehr auf Ameisen und Termiten, die sich als tierische Nahrung für Menschen nicht sonderlich eignen. Raupen, Käfer, Schaben, Motten, Spinnen, Frösche und anderes Kleingetier kommen hinzu. Größere und große Tiere, die als Jagdbeute taugen, bilden den ganz kleinen Rest der ohnehin kleinen tierischen Gesamtbiomasse. Für die indigenen Jäger und Sammler stellt die Jagdbeute eine Ergänzung dar. Sie gleicht mit tierischen Proteinen den Eiweißmangel aus, der bei ihrer stärke- und...
| Erscheint lt. Verlag | 16.8.2021 |
|---|---|
| Illustrationen | Johann Brandstetter |
| Zusatzinfo | Mit 14 Bildtafeln und 32 Vignetten |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Natur / Technik ► Naturwissenschaft |
| Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Ethik | |
| Technik | |
| Schlagworte | Amazonas • Artenvielfalt • Bestseller Autor • Biodiversität • Fauna • Flora • Illustrationen • Josef Reichholf • Klimawandel • Massentierhaltung • Regenwald • Regenwaldzerstörung • Rettung der Regenwälder • Schönheit • Wissensbuch des Jahres |
| ISBN-10 | 3-8412-2688-4 / 3841226884 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-2688-4 / 9783841226884 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 20,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich