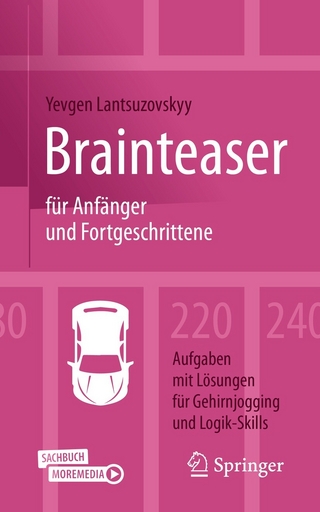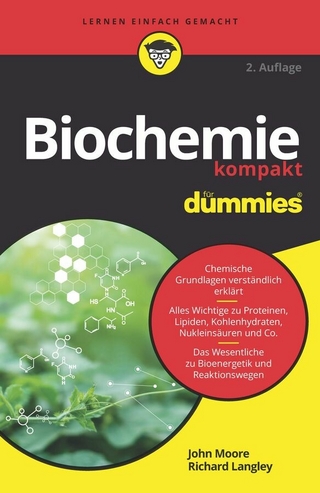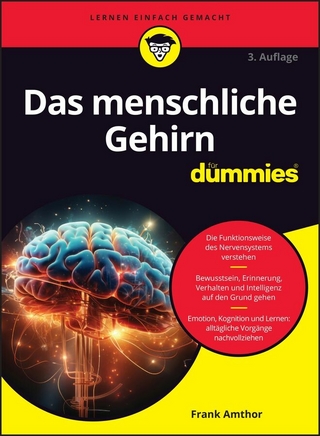Eine kurze Reise durch Geist und Gehirn (eBook)
192 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-00539-6 (ISBN)
Vilayanur S. Ramachandran ist Neurowissenschaftler und Direktor des «Center for Brain and Cognition» in San Diego und Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der University of California. Er ist Mitglied im «Century Club» der Newsweek, der die hundert wichtigsten Menschen für die Zukunft Amerikas umfasst. Er lebt in Del Mar, Kalifornien.
Vilayanur S. Ramachandran ist Neurowissenschaftler und Direktor des «Center for Brain and Cognition» in San Diego und Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der University of California. Er ist Mitglied im «Century Club» der Newsweek, der die hundert wichtigsten Menschen für die Zukunft Amerikas umfasst. Er lebt in Del Mar, Kalifornien. Hainer Kober, geboren 1942, lebt in Soltau. Er hat u.a. Werke von Stephen Hawking, Steven Pinker, Jonathan Littell, Georges Simenon und Oliver Sacks übersetzt.
Vorwort
Es war eine große Ehre für mich, als man mich bat, die Reith-Vorträge 2003 zu halten: Damit war ich der erste Mediziner und Experimentalpsychologe, der eingeladen wurde, seit Bertrand Russell die Vortragsreihe 1948 ins Leben rief. In den letzten fünfzig Jahren haben die Vorträge einen festen Platz im geistigen und kulturellen Leben Großbritanniens gefunden, und ich habe die Einladung mit großer Freude angenommen. Die Liste derer, die mir vorausgingen, umfasst die Helden meiner Jugend: Peter Medawar, Arnold Toynbee, Robert Oppenheimer, John Galbraith und Russell selbst – um nur einige zu nennen.
Mir war klar, dass es angesichts der überragenden Bedeutung und des prägenden Einflusses meiner Vorgänger schwer sein würde, in ihre Fußstapfen zu treten. Noch mehr schüchterte mich die Vorgabe ein, dass die Vorlesungen nicht nur für Fachleute interessant, sondern auch für ein «Laienpublikum» verständlich sein sollten, wie es Lord Reiths ursprüngliches Konzept für die BBC-Reihe vorsah. In Anbetracht der Fülle neurowissenschaftlicher Forschungsergebnisse blieb mir also nichts anderes übrig, als mich mit einem impressionistischen Überblick zu begnügen, statt mich an einer erschöpfenden Darstellung zu versuchen. Zwar befürchtete ich, dass ich die Sachverhalte dabei zu sehr vereinfachen und dadurch einige meiner Kollegen verärgern würde, doch ich tröstete mich mit Lord Reiths eigenen Worten: «Es gibt Menschen, die zu verärgern unsere Pflicht ist.»
Es hat mir viel Freude gemacht, durch Großbritannien zu reisen und die Vorträge zu halten. Der erste, der in Londons Royal Institution stattfand, war für mich ein besonders festliches und denkwürdiges Ereignis, nicht nur, weil ich unter den Zuhörern viele vertraute Gesichter ehemaliger Lehrer, Kollegen und Studenten erblickte, sondern auch, weil es derselbe Vortragssaal war, in dem Michael Faraday zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus nachwies. Fast konnte ich seine Anwesenheit spüren, vermutlich etwas ungehalten über meine unbeholfenen Versuche, den Zusammenhang zwischen Gehirn und Geist darzulegen.
Mir ging es in diesen Vorträgen immer darum, die Neurowissenschaften – die Gehirnforschung – einem breiteren Publikum (dem «arbeitenden Menschen», wie Thomas Huxley gesagt hätte) zugänglich zu machen. Die Strategie ist einfach: Wir untersuchen eine neurologische Funktionsstörung, die durch eine Veränderung in einer winzigen Hirnregion des Patienten hervorgerufen wird, und fragen uns, warum der Patient diese sonderbaren Symptome zeigt. Was verraten uns die Symptome über die Funktion des gesunden Gehirns? Können wir durch eine sorgfältige Untersuchung dieser Patienten erklären, wie die Aktivität der hundert Milliarden Neuronen im Gehirn die Komplexität unserer bewussten Erfahrung hervorruft? Angesichts der zeitlichen Einschränkungen, denen ich unterworfen war, habe ich mich auf die Felder beschränkt, auf denen ich selbst gearbeitet habe (Phantomglieder, Synästhesie und visuelle Verarbeitung), sowie auf Bereiche, die mit einem breiten, interdisziplinären Interesse rechnen können, weil sie eines Tages vielleicht die Kluft zwischen C.P. Snows «zwei Kulturen» schließen werden – zwischen den Natur - und den Geisteswissenschaften.
Im dritten Vortrag geht es um ein besonders strittiges Thema: die neurologische Basis künstlerischer Erfahrungen – die «Neuro-Ästhetik» –, die unter Naturwissenschaftlern gewöhnlich als Tabuzone gilt. Spaßeshalber werde ich mich daran versuchen, nur um zu zeigen, wie ein Neurowissenschaftler dieses Problem angehen könnte. Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich damit auf ein höchst spekulatives und unsicheres Gebiet vorwage. Peter Medawar hat einmal gesagt: «Wissenschaft ist ihrem Wesen nach eine phantastische Reise in eine Welt, die wahr sein könnte.» Spekulationen sind also zulässig, solange sie zu überprüfbaren Vorhersagen führen und solange der Autor deutlich macht, wann er sich auf Spekulationen einlässt und wann nicht, mit anderen Worten, wann er sich auf dünnem Eis bewegt und wann er festen Boden unter den Füßen hat. Ich habe mich bemüht, diese Unterscheidung im gesamten Buch durchzuhalten. Gelegentlich habe ich sie durch entsprechende Endnoten verdeutlicht.
Im Bereich der Neurologie gibt es einen grundsätzlichen Meinungsstreit zwischen den Vertretern der «Einzelfallstudie», der eingehenden Untersuchung von nur ein oder zwei Patienten mit dem gleichen Syndrom, und den Verfechtern der quantitativen Studien, die an umfangreichen Patientenstichproben statistische Analysen vornehmen. Gegen das erste Verfahren wird gelegentlich eingewandt, man könne allzu leicht durch einen einzigen seltsamen Fall auf eine falsche Fährte gelockt werden, doch das ist unsinnig. Die meisten Definitionen neurologischer Syndrome, die sich über längere Zeit bewährt haben, etwa die Hauptformen der Aphasie (Sprachstörungen), die Amnesie (die von Brenda Milner, Elizabeth Warrington, Larry Squire und Larry Weiskrantz erforscht wurde), die kortikale Farbenblindheit, das Neglect-Syndrom, das Blindsehen (Blindsight), das Split-Brain-Syndrom (Durchtrennung des Balkens) und so fort, sind ursprünglich durch sorgfältige Einzelfallstudien entdeckt worden. Mir ist kein einziges Syndrom bekannt, das durch die Ergebnisse einer großen Stichprobe gefunden wurde. Am besten beginnt man tatsächlich mit der Untersuchung von Einzelfällen und überprüft dann, ob sich die Ergebnisse zuverlässig an anderen Patienten wiederholen lassen. Das gilt für die meisten Erkenntnisse, von denen ich in diesen Vorträgen berichten werde – Phantomglieder, Capgras-Syndrom (Doppelgängerillusion), Synästhesie und Neglect-Syndrom. Die Ergebnisse sind bei allen Patienten bemerkenswert ähnlich und wurden von vielen Forschern bestätigt.
Häufig werde ich von Kollegen und Studenten gefragt, wann und weshalb ich anfing, mich für das Gehirn zu interessieren. Es ist nicht einfach, den Ursprung der eigenen Interessen zu bestimmen. Ich will es trotzdem versuchen. Schon mit elf Jahren begann ich mich für naturwissenschaftliche Fragen zu interessieren. Soweit ich mich erinnere, war ich etwas eigenbrötlerisch und unbeholfen im sozialen Umgang, hatte aber einen wirklich guten Freund in Bangkok, der meine Liebe zur Wissenschaft teilte: Somthau (‹Cookie›) Sucharitkul. Vor allem aber fühlte ich mich wohl in der Gesellschaft der Natur, und vielleicht war die Naturwissenschaft auch meine «Zuflucht» vor der sozialen Welt mit ihrer Willkür und ihren verwirrenden Konventionen. Ich verbrachte viel Zeit damit, Muscheln, Gesteinsproben und Fossilien zu sammeln. Mit Begeisterung vertiefte ich mich in die Archäologie der Antike, in Kryptographie (Indusschrift), vergleichende Anatomie und Paläontologie. So fand ich es unglaublich faszinierend, dass sich die winzigen Knochen in unseren Ohren, mit denen die Säugetiere den Schall verstärken, aus den Kieferknochen der Reptilien entwickelt haben. In der Schule begeisterte ich mich für die Chemie. Häufig mischte ich chemische Stoffe, um zu sehen, was passieren würde (ein Stück brennendes Magnesiumband konnte ins Wasser geworfen werden und brannte unter Wasser weiter, wobei es dem H2O Sauerstoff entzog). Meine zweite Leidenschaft war die Biologie. Einmal versuchte ich, den «Mund» von Venusfliegenfallen mit verschiedenen Zuckern, Fettsäuren und einzelnen Aminosäuren zu füttern, um zu sehen, welche Stoffe sie veranlassten, sich zu schließen und Verdauungsenzyme auszuschütten. In einem anderen Experiment wollte ich herausfinden, ob Ameisen den Süßstoff Saccharin horteten und verzehrten, das heißt, ob sie ihn genauso gern mochten wie Zucker. Würden die Saccharin-Moleküle ihre Geschmacksnerven auf die gleiche Weise «täuschen» wie die unseren?
All diese – «viktorianisch» inspirierten – Beschäftigungen hatten wenig mit den Dingen zu tun, mit denen ich mich heute befasse: Neurologie und Psychophysik. Doch offenbar haben mich diese Kindheitsinteressen nachhaltig in meiner «erwachsenen» Persönlichkeit und in meiner wissenschaftlichen Vorgehensweise geprägt. Mochte das, womit ich mich beschäftigte, auch noch so schwierig und rätselhaft sein, ich hatte immer das Gefühl, mich auf meinem eigenen Gebiet zu bewegen, in einem privaten Paralleluniversum, das von Menschen bewohnt wurde wie Darwin, Cuvier, Huxley, Owen, William Jones und Champollion. Sie waren für mich «wirklicher» – auf jeden Fall lebendiger – als die meisten lebenden Personen, die ich kannte. Vielleicht hat diese Flucht in meine eigene Welt dazu geführt, dass ich mich als jemand Besonderes empfand und nicht als «seltsam», eigenbrötlerisch oder anders. Sie verhalf mir dazu, Langeweile und Eintönigkeit zu besiegen, mich der faden Existenz zu entziehen, welche die meisten Menschen als «normales Leben» bezeichnen, und einen Ort aufzusuchen, wo, um Russell zu zitieren, «wenigstens einer unserer edleren Triebe dem öden Exil der realen Welt entfliehen kann».
An der Universität von Kalifornien in San Diego, einer Institution, die so altehrwürdig wie lebendig und modern ist, wird man zu solchen «Fluchten» ausdrücklich ermuntert. Ihr neurowissenschaftliches Programm wurde kürzlich in einem Vergleich aller amerikanischen Universitäten von der National Academy of Sciences auf Platz eins gesetzt. Zählt man das Salk Institute und Gerry Edelmans Neurosciences Institute hinzu, so gibt es in La Jollas «Neuron Valley» eine höhere Konzentration von Neurowissenschaftlern als irgendwo anders auf der Welt. Jemand, der sich...
| Erscheint lt. Verlag | 13.2.2024 |
|---|---|
| Übersetzer | Hainer Kober |
| Zusatzinfo | Mit 6 s/w Abb. |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Natur / Technik ► Naturwissenschaft |
| Technik | |
| Schlagworte | Ästhetik • Evolutionstheorie • Fallbeispiele • Gehirnforschung • Geist • Körper • Nervensystem • Neurowissenschaften • Philosophie • Vorlesungsessays |
| ISBN-10 | 3-644-00539-7 / 3644005397 |
| ISBN-13 | 978-3-644-00539-6 / 9783644005396 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 9,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich