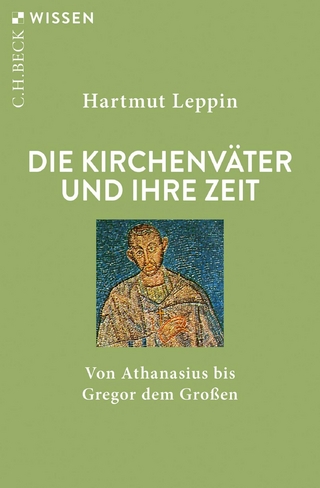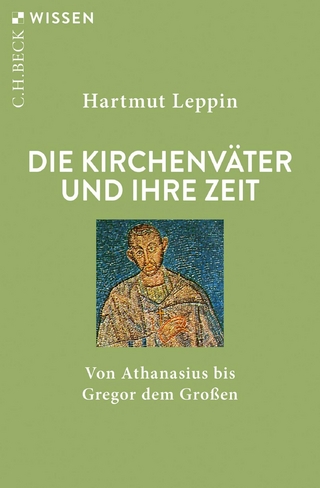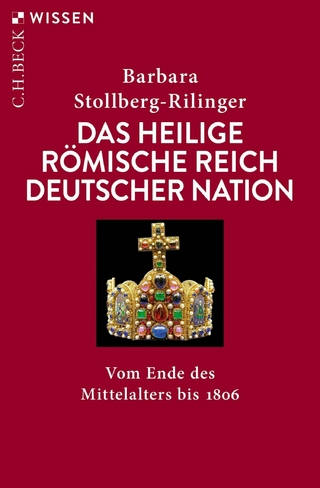Bauern und Banker (eBook)
288 Seiten
wbg Academic in der Verlag Herder GmbH
978-3-8062-4436-6 (ISBN)
Thomas Ertl ist Professor für Geschichte des hohen und späten Mittelalters am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Seit 2017 ist er Mitglied des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. Als Mitherausgeber wirkte er von 2010 bis 2018 an 'The Medieval History Journal' und seit 2018 bei der 'Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte' mit. 2008 veröffentlichte er das Buch 'Seide, Pfeffer und Kanonen. Globalisierung im Mittelalter'.
Thomas Ertl ist Professor für Geschichte des hohen und späten Mittelalters am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Seit 2017 ist er Mitglied des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. Als Mitherausgeber wirkte er von 2010 bis 2018 an „The Medieval History Journal“ und seit 2018 bei der „Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ mit. 2008 veröffentlichte er das Buch „Seide, Pfeffer und Kanonen. Globalisierung im Mittelalter“.
Vorwort 6
Einleitung 9
Transformationen – Das fruhe Mittelalter (500–1000) 23
Gute Aussichten – Das hohe Mittelalter (1000–1300) 57
Neuordnung – Das spate Mittelalter (1300–1500) 91
Strukturen – Rahmenbedingungen und Institutionen 125
Lebensstandards – Reichtum und Armut 163
Warenwelten – Konsum und Shopping im Mittelalter 199
Globales Mittelalter – Europa im Vergleich 227
Quellenkunde – Woher kommt unser Wissen? 245
Wirtschaftsgeschichte – Ein Fach im Wandel 279
Danksagung 287
Auswahlbibliografie 289
Abbildungsverzeichnis 301
»Viel Fachwissen, gut und mit Gewinn lesbar.« National Geographic History
Transformationen
Das frühe Mittelalter (500–1000)
Das frühe Mittelalter von 500 bis 1000 ist eine für die Wirtschaftsgeschichte wichtige Epoche, weil sich in dieser Zeit umfangreiche Transformationen der Wirtschafts- und Sozialordnung vollzogen haben und weil diese Veränderungen von der Geschichtswissenschaft seit über einhundert Jahren widersprüchlich bewertet worden sind. Im Zusammenspiel mit anderen Erklärungsmustern spielten wirtschaftsgeschichtliche Argumente in diesen Diskussionen stets eine prominente Rolle. Zwei zusammenhängende Fragen stehen dabei meist im Mittelpunkt: Wie vollzog sich der Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter und wie sahen die Grundzüge der frühmittelalterlichen Wirtschaft aus? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bewertung dieser Fragen geändert: An die Stelle der Zäsur trat die Transformation und an die Stelle des Niedergangs trat der Wandel. Problematisch geworden ist sogar die Periodisierung selbst, denn Spezialistinnen und Spezialisten dieser Epoche des Übergangs betrachten die Zeitspanne vom 4. bis zum 9. Jahrhundert mit guten Gründen als eine eigenständige, »expandierende« Epoche.
Kontinuitäten und Diskontinuitäten sind freilich nur im historischen Rückblick erkennbar, weshalb ihre Bewertung stets von einer selektiven Wahrnehmung geprägt ist. Dies gilt ganz besonders für den Übergang von der Antike zum Mittelalter. Hinzu kommt eine selbst für mittelalterliche Verhältnisse spärliche Quellenlage. Seit dem 5. Jahrhundert ging die Schriftlichkeit im westlichen Europa zurück. Erst aus der karolingischen Zeit sind schriftliche Zeugnisse wie Urkunden, Urbare (das Urbarium ist ein Verzeichnis über die Besitzrechte einer Grundherrschaft und die zu erbringenden Leistungen ihrer Untertanen [Grundholden] und somit eine bedeutende Wirtschafts- und Rechtsquelle der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Agrarverfassung) und historiografische Texte wieder in größerem Umfang erhalten – diese Texte der Karolingerzeit überformten zudem die ältere Überlieferung.
Während sich im westlichen Europa die Gesellschaften der römischen Provinzen Italiens, Galliens, Germaniens und der iberischen Halbinsel aufgrund der Ausbreitung des Christentums und der Integration neuer Volksgruppen nachhaltig veränderten, bestand im Südosten das römische Imperium in Gestalt des byzantinischen Reiches weiter. Doch auch hier wandelte sich die Bevölkerung nach dem Zuzug slawischer und anderer Gruppen. Der Norden und der Osten des europäischen Kontinents wurden durch Missionierung, Handel und Kriege zunehmend mit den politischen und wirtschaftlichen Zentren verbunden. Seit dem 7. Jahrhundert schufen die Araber neue Herrschafts- und Wirtschaftsformen im Nahen Osten und darüber hinaus. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief in diesen Großregionen sehr unterschiedlich. Selbst innerhalb der einzelnen Räume kann von einer einheitlichen Entwicklung nicht die Rede sein. Die kleinräumigen Entwicklungspfade divergierten so stark, dass sogar die Frage gestellt wurde, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einer einzigen großen Transformation zu sprechen.
Das Ergebnis der verschiedenen Wandlungsprozesse war die Entstehung einer mittelalterlichen Welt, deren Gesellschafts- und Wirtschaftsform häufig als Feudalismus bezeichnet wird. Der Begriff ist unscharf, wird häufig zur Abgrenzung vom Kapitalismus verwendet und weist zwei Dimensionen auf. Einerseits ist damit das Lehenswesen gemeint, also die Beziehung zwischen einem landbesitzenden Herren (dominus; einem Fürsten, hohen Geistlichen oder Adeligen) und einem von ihm abhängigen Mann (vasallus), die durch die Übergabe (Leihe) von Land (feudum oder beneficium) oder staatlichen Hoheitsrechten gegen Dienst und Herrschaftsteilhabe gekennzeichnet ist. Über Entstehung und Ausgestaltung des Lehenswesens wird in der aktuellen Forschung heftig und kontrovers diskutiert. Andererseits bezeichnet Feudalismus die Herrschaft einer grundbesitzenden Klasse über die abhängige Landbevölkerung im Rahmen der Grundherrschaft. Dieser Begriff ist in den letzten Jahren ebenfalls in die Kritik geraten. Das feudale Produktionssystem – bestehend aus landbesitzenden Herren oder Institutionen und ausgebeuteten Bauern – existierte nicht nur in Europa und nicht nur im Mittelalter. Bis weit in die frühe Neuzeit hinein dominierten auf Grund- und Bodeneigentum beruhende ländliche Herrschafts- und Wirtschaftsverhältnisse alle anderen Wirtschaftssektoren, und zwar in allen Ländern der Erde.
Feudale Verhältnisse wirken somit auf doppelte Weise der allgemein üblichen Definition eines modernen Staates entgegen: Es gab keine Zentralregierung, die das Gewaltmonopol ausübte und von allen Untertanen Steuern erhob, und es existierte kein rechtlich homogenes Staatsvolk, da der Großteil der bäuerlichen Bevölkerung nicht vom König, sondern von Grundherren abhängig war. Wirtschaftlich bedeutet dies, dass es bis zum späten Mittelalter kaum freie Lohnarbeit gab, weil viele Bauern Land bewirtschafteten, das sich nicht in ihrem Eigentum befand. Für die Nutzung mussten sie Abgaben in Form von Geld und Naturalien sowie Frondienste (Arbeitsdienste) leisten. Öffentliche Aufgaben und Befugnisse wurden in diesem System von vielen kleinen und großen Herrschaftsträgern auf unterschiedlichen Ebenen – von der kleinen Grundherrschaft bis zum großen Königreich – durchgeführt und ausgeübt.
Der Untergang des weströmischen Reichs
Die humanistischen Gelehrten der Renaissance betonten den Unterschied zwischen der Antike und ihrer eigenen Epoche auf der einen Seite und der dazwischen liegenden finsteren mittleren Zeit auf der anderen. Die Epochengrenze zwischen Antike und Mittelalter, meist festgemacht am Sturz des letzten Westkaisers im Jahr 476, verfestigte sich in den folgenden Jahrhunderten und prägt noch heute die in der westlichen Geschichtswissenschaft übliche Einteilung in Perioden. Einher ging damit eine Betonung des radikalen Bruchs zwischen Antike und Mittelalter. Für den Untergang des weströmischen Reichs wurden verschiedene Faktoren verantwortlich gemacht, von denen drei die Diskussion bis ins 20. Jahrhundert dominierten: Die außenpolitische Erklärung sieht die Ursache im Eindringen germanischer und anderer Völker ins Imperium Romanum und interpretiert dabei die Germanen entweder als positive Erneuerer eines im Verfall befindlichen Staats oder als barbarische Zerstörer einer Hochkultur. Die innenpolitische Erklärung führt dagegen die Verwandlung des römischen Reichs in einen repressiven Zwangsstaat als Hauptursache des Untergangs an. Sozioökonomische Erklärungsansätze betonten wiederum den wirtschaftlichen Niedergang der Sklavenwirtschaft sowie den damit verbundenen Rückgang des Städtewesens und der Bevölkerung. Alle drei Erklärungsmodelle sind selektive Interpretationen. Insbesondere die positive oder negative Bewertung der Germanen und der Römer diente von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert einer Legitimierung nationaler Geschichtsbilder.
Im 20. Jahrhundert veränderten sich die Sichtweisen. Bereits in den Jahrzehnten vor und nach 1900 machten Numa Denis Fustel de Coulanges und Alfons Dopsch auf die großen Kontinuitäten zwischen Spätantike und Frühmittelalter aufmerksam. Der duale Antagonismus zwischen »Germanen« und »Römern« hat sich in der Forschung der letzten Jahrzehnte ebenfalls relativiert, da beide Gruppen nicht mehr als homogene Einheiten wahrgenommen werden. Als eine Zäsur wird heute zudem das Ende der Expansion des römischen Reiches im 2. Jahrhundert wahrgenommen, weil dadurch die Zufuhr von importierten Ressourcen und vor allem von Sklaven zum Erliegen kam. Insgesamt dominiert gegenwärtig die Überzeugung, dass monokausale Erklärungen der komplexen Entwicklung nicht gerecht werden. Aus moderner Sicht war es ein umfassendes Zusammenspiel zahlreicher Faktoren, das einen komplexen und Jahrhunderte andauernden Transformationsprozess auslöste, der den Übergang von der Antike ins Mittelalter prägte. Diese Zeit großer Veränderungen wird zudem nicht mehr als eine Periode des Verfalls, sondern als Zeitraum kreativer und produktiver Adaptierungen gesehen. Da die einzelnen Faktoren des Prozesses weiterhin unterschiedlich gewichtet werden, gibt es bis heute keine einheitliche Sichtweise darüber, welche wirtschaftlichen Faktoren welche Auswirkungen hatten.
Die Wirtschaft im frühmittelalterlichen Byzanz
Die Deutung der oströmisch-byzantinischen Geschichte hat sich im 20. Jahrhundert gleichermaßen verändert. Seit dem Mittelalter dominierte im westlichen Europa eine vorurteilsbeladene Sicht, die das oströmische Kaiserreich als dekadente und halborientalische Despotie wahrnahm. Edward Gibbon verewigte dieses Bild in seiner berühmten History of the Decline and Fall of the Roman Empire, die zwischen 1776 und 1789 veröffentlicht wurde. Aus dieser Perspektive wurde die Entwicklung der byzantinischen Wirtschaft als eine Geschichte des Niedergangs geschrieben. Allerdings interessierte sich die ältere Geschichtsschreibung wenig für sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Faktoren, sondern konzentrierte sich vor allem auf Verfassung und...
| Erscheint lt. Verlag | 23.9.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Darmstadt |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Mittelalter |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Mittelalter | |
| Schlagworte | Alltagleben im Mittelalter • Fernhandel • Geldwesen • Handel • Handelbeziehung • Handel im Mittelalter • Hansestädte • Kaufmannsgilden • lokaler Handel • Messewesen • Mittelalter • mittelalterlicher handel • mittelalterliches alltagsleben • mittelalterliche Städte • Mittelalterliche Wirtschaft • Naturalwirtschaft • Stände • Überblicksliteratur • warenaustausch • Wikinger • Wirtschaft • Wirtschaftsgeschichte • Zünfte |
| ISBN-10 | 3-8062-4436-7 / 3806244367 |
| ISBN-13 | 978-3-8062-4436-6 / 9783806244366 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 21,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich