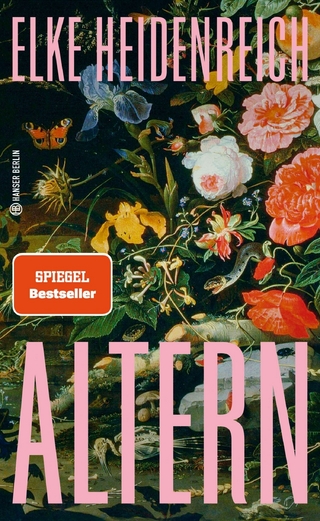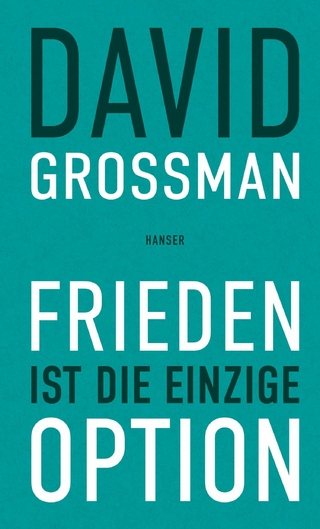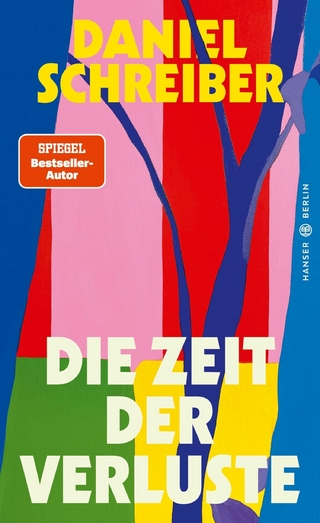Vom Aufstieg und anderen Niederlagen (eBook)

352 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-30840-2 (ISBN)
Giovanni di Lorenzo, geboren 1959 in Stockholm. Nach dem Studium in München Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Ab 1999 Chefredakteur beim Berliner Tagesspiegel, seit 2004 Chefredakteur der ZEIT. Seit 1989 Moderator bei »3nach9« (Radio Bremen). Seit 2021 betreibt er mit Florian Illies den Kunst-Podcast »Augen zu«. Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch: »Wofür stehst du« mit Axel Hacke (2010); »Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt« (2011) und »Verstehen Sie das, Herr Schmidt?« (2012), beide mit Helmut Schmidt, der Interviewband »Vom Aufstieg und anderen Niederlagen« (2014) und »Erklär mir Italien« mit Roberto Saviano (2017).
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 16/2016) — Platz 19
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 15/2016) — Platz 19
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 14/2016) — Platz 18
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 13/2016) — Platz 14
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 12/2016) — Platz 15
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 11/2016) — Platz 14
- Spiegel Bestseller: Sachbuch / Taschenbuch (Nr. 10/2016) — Platz 15
Giovanni di Lorenzo, geboren 1959 in Stockholm. Nach dem Studium in München Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Ab 1999 Chefredakteur beim Berliner Tagesspiegel, seit 2004 Chefredakteur der ZEIT. Seit 1989 Moderator bei »3nach9« (Radio Bremen). Seit 2021 betreibt er mit Florian Illies den Kunst-Podcast »Augen zu«. Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch: »Wofür stehst du« mit Axel Hacke (2010); »Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt« (2011) und »Verstehen Sie das, Herr Schmidt?« (2012), beide mit Helmut Schmidt, der Interviewband »Vom Aufstieg und anderen Niederlagen« (2014) und »Erklär mir Italien« mit Roberto Saviano (2017).
»Auschwitz erlaubt keine Rührung«
Renate Lasker-Harpprecht
Dieses Gespräch liegt mir besonders am Herzen, auch wenn es sich von den anderen Interviews in diesem Buch deutlich abhebt. Es geht hier nicht um Aufstieg oder Niederlage eines Menschen. Diese Kategorien verbieten sich in diesem Fall sogar. Es ist ein Blick in die schlimmsten Abgründe der Menschheit. Und ich muss gestehen: In der Zeit der Vorbereitung auf die Begegnung mit Renate Lasker-Harpprecht, die Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat, kam mir nicht nur einmal der Gedanke, dass ich über den Holocaust doch schon so viel weiß. Da ging es mir nicht anders als vermutlich vielen zweifelnden Lesern vor der Lektüre des Interviews: Will ich das alles wirklich noch mal hören?
Ich musste also einen beträchtlichen inneren Widerstand überwinden, um dann umso verstörter und auch beschämter von der Begegnung zurückzukommen. Gar nichts hatte ich mir vorher richtig vorstellen können! Wie nah das alles plötzlich war – und wie unfassbar es bleibt, was den Juden von den Deutschen angetan worden ist.
Auf das Gespräch brachte mich Klaus Harpprecht, der große Publizist, der bis heute auch immer wieder für die ZEIT schreibt. Er hatte mir öfter von seiner Frau erzählt und davon, wie schwer es ihr falle, das Erlebte mit anderen zu teilen, sogar mit ihm. Bei einem seiner Besuche in Hamburg erwähnte er eines Tages einen Satz seiner Frau, der für sie offenbar die größte Form der Liebesbezeugung war und mir dennoch einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Renate Lasker-Harpprecht hatte zu ihrem Mann gesagt: »Ich weiß, dass du mitgegangen wärst.« Gemeint war: ins Lager, vielleicht auch in den Tod. Man merkte Klaus Harpprecht seine Verlegenheit an. Ich fragte, ob es vielleicht denkbar wäre, dass sie mit der ZEIT sprechen würde.
Wir trafen uns in einem Dorf in Südfrankreich, wo die beiden seit den Achtzigerjahren leben. Zwei Dinge fielen mir an Renate Lasker-Harpprecht besonders auf: Sie konnte ihre Erinnerungen viel nüchterner und linearer ordnen als viele andere Opfer, deren Aussagen ich bis dahin kannte. Zum anderen war sie in der Lage, ihre Erlebnisse auch mit 70 Jahren Abstand noch aus der Perspektive einer Heranwachsenden zu schildern, was sie zu einer außergewöhnlichen Zeugin macht.
Das lange Gespräch in der ZEIT hat zu vielen spontanen und sehr mitfühlenden Reaktionen geführt, von Leserinnen und Lesern, aber auch von Weggenossen, deren Spuren sie schon lange verloren hatte. Die Zeitung La Repubblica hat es in großen Teilen und auf vier Seiten nachgedruckt, verbunden mit einem Aufruf, den ich mir nach dem Gespräch so sehr gewünscht hatte: ein Versuch, die Identität jenes kleinen, blonden Mädchens aus Italien herauszufinden, dessen Schicksal Renate Lasker-Harpprecht bis heute mehr als vieles andere bewegt.
Ihr Mann hat mir gesagt, dass Sie so gut wie nie über Ihre Zeit im Konzentrationslager reden, auch mit ihm nicht.
Wir reden nicht so schrecklich viel darüber.
Fällt es Ihnen mit 90 Jahren denn etwas leichter als früher, davon zu erzählen, was Ihnen in Auschwitz und in Bergen-Belsen widerfahren ist?
Ja, aber nur mit bestimmten Personen. Und nicht unbedingt mit Klaus: Bei dem habe ich das Gefühl, dass er sowieso alles weiß. Ich habe auch Angst, die Leute zu langweilen.
Müssten Sie nicht eher Angst haben, dass Ihnen das Erzählen zu sehr wehtut? Dass die Menschen unsensibel oder grob reagieren?
Ich würde niemals mit Menschen reden, die grob reagieren könnten. Aber ich werde oft gefragt, warum ich nicht mit Bekannten oder Freunden gesprochen habe. Und sehr viele Menschen wundern sich über meine Antwort: Man hat uns nicht gefragt.
Die Leute wollten gar nicht so viel wissen?
Die Deutschen wollten es nicht wissen.
Wie erklären Sie sich das?
Einerseits schämen sie sich alle irgendwie, weil es ja um Deutschland geht. Aber sie tun auch etwas, das mir sehr auf die Nerven geht: Sie fangen sofort an, von ihrem eigenen schrecklichen Schicksal im Krieg zu erzählen. Wie sie ausgebombt wurden. Dann breche ich das Gespräch ab. Der verstorbene Schriftsteller Hans Sahl hat einen Satz geprägt, den ich immer benutze, wenn es nützlich ist: »Wir sind die Letzten. Fragt uns aus!«
Sie sind in Breslau aufgewachsen. Wann haben Sie die Feindseligkeit gegenüber den Juden zum ersten Mal bemerkt?
Im Gegensatz zu meiner Schwester Anita habe ich keine persönliche Anfeindung erlebt. Was in dieser Zeit sehr wichtig war: Ich sehe nicht, wie man so schön sagt, besonders jüdisch aus. Ich habe keine krumme Nase, ich habe keine kohlschwarzen Haare. (lacht) Meine Schwester dagegen ist im Grunde genommen ein sephardischer Typ, sie hatte blauschwarze Haare und einen Zinken. Das war ganz schlecht.
Und Ihre Mitschüler, waren die bösartig?
Nein, das kann ich nicht sagen. Aber da waren diese fabelhaften Eltern, die ihre Kinder sofort in die Hitlerjugend stecken wollten. Ich hatte damals eine Freundin, die einen großen Namen trug: Hella Menzel, eine Nachfahrin von Adolph von Menzel.
Dem berühmten Maler?
Ja, mit der war ich sehr gut befreundet. Sie hat oft bei uns übernachtet, ich war auch öfter bei ihr. Dann kam der Nazi-Umschwung, und ich war wieder mit ihr verabredet. Als ich sie abholen wollte, machte das Dienstmädchen die Tür auf und sagte: »Die gnädige Frau möchte nicht mehr, dass Sie unsere Wohnung betreten.« Da war ich erst ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber …
Sie haben Hella Menzel nie wieder gesehen?
Doch, ich habe sie heimlich noch ein paarmal getroffen. Aber dann habe ich gesagt: »Ich mache das jetzt nicht mehr mit, sonst kriegst du Ärger mit deinen Eltern!« Ich nehme an, sie hat sich ein bisschen geschämt. Denn sie war wirklich nett.
Ich weiß, dass so viel Schlimmeres kam. Dennoch muss diese Abweisung an der Haustür für Sie als Mädchen doch sehr kränkend gewesen sein.
Natürlich. Aber man entwickelt, nachdem das ja alles verhältnismäßig schnell ging, eine dicke Haut. Sonst geht’s überhaupt nicht.
Wie hat denn Ihr Vater reagiert, als die Ausgrenzung der Juden begann?
Es kam ja schlagartig. Wer hätte einen denn vor 1933 auf der Straße ein Judenschwein genannt? Mein Vater hat sich mit Deutschland identifiziert. Er sagte: »Man wird doch diesem Wahnsinnigen sehr bald zeigen, dass wir das nicht gewollt haben!« Deshalb hat er sich auch nicht genug um die Emigration gekümmert. Er ist noch mit dem Schiff nach Israel gereist, damals Palästina, um sich das anzugucken. Aber er ist wieder zurückgekommen.
Er wollte da nicht leben?
Ja, wissen Sie, wenn man ein sehr prominenter und außerordentlich guter Anwalt ist und in ein völlig anderes Land geht, was macht man da?
Hat denn auch die Reichspogromnacht 1938 Ihren Eltern nicht das Gefühl vermittelt: »Nichts wie weg«?
Doch, schon. Man sah immer weniger Juden auf den Straßen. Aber es war überhaupt nicht einfach, das Land zu verlassen. Die anderen Länder wollten nicht unbedingt jüdische Emigranten haben. Mein Vater hat versucht, uns nach Italien zu bringen. Er war ja ein großer Freund der italienischen Kultur. Und es hätte beinahe geklappt! Wir hatten sogar schon unsere Möbel mit einem riesigen Container losgeschickt. Die sind nie wieder aufgetaucht. Wir hatten keine Möbel mehr, wir mussten aus der Wohnung raus, und wir haben dann zusammengepfercht bei Verwandten gelebt, mit denen wir eigentlich nicht schrecklich viel am Hut hatten. Anita und ich wurden zur Zwangsarbeit eingezogen.
Ihre Räume wurden buchstäblich immer enger. Hatten Sie da schon große Angst? Oder haben Sie das verdrängt?
Uns hat sicher beim Überleben geholfen, dass wir im Grunde genommen sehr sorglos waren. Wir haben immer nur von einem Tag auf den anderen gelebt.
Weil Sie so jung waren?
Wir waren so jung. Und wir mussten den Alltag meistern. Als der Krieg ausgebrochen war, mussten wir ja furchtbar schuften. Anita und ich haben in einer Papierfabrik gearbeitet und Klopapier fabriziert. Vorher war ich bei der Müllabfuhr, das war noch schlimmer. Da mussten wir Metallteile aus dem Müll suchen, zwischen Ratten und toten Katzen.
Am 9. April 1942 wurden Ihre Eltern deportiert. Wussten Sie vorher, dass sie jetzt abgeholt werden?
Nein, die wurden nicht abgeholt, und es trommelte keiner an der Tür. Meine Eltern hatten eine Mitteilung bekommen: »Am nächsten Morgen um soundso viel Uhr kommen Sie zum Sammellager …« Und man ging halt da hin. Man hat gehorcht. Eigentlich hätten viel mehr Leute abhauen sollen.
Man ist selbst zur Schlachtbank gegangen?
Ja, man ist zur Schlachtbank gegangen. Am Abend vorher haben meine Eltern gepackt, man durfte 20 Pfund Kleidung mitnehmen oder so. Und da haben wir uns verabschiedet. Mein Vater hat meiner Schwester noch eine Art Testament diktiert. Ich bin irgendwann schlafen gegangen. Ich schäme mich dafür immer, aber ich konnte nicht mehr. Meine Mutter saß im Nebenzimmer und weinte. Das hörte ich noch. Sie wusste, dass sie ihre Kinder nicht wiedersehen würde.
Haben Ihre...
| Erscheint lt. Verlag | 2.10.2014 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Angela Merkel • Anne-Sophie Mutter • Armin Mueller-Stahl • Boris Becker • Eberhard von Brauchitsch • Erinnerungen • Gespräche • Giovanni di Lorenzo • Giovanni Trappatoni • Halil Andic • Hans-Jürgen Wischnewski • Helga von Brauchitsch • Helmut Dietl • Helmut Schmidt • Interview • Interviews • Joachim Gauck • Karl-Theodor zu Guttenberg • Luca Toni • Matteo Renzi • Moderator • Monica Lierhaus • Petra Kelly • Prominent • Prominente • Renate Lasker-Harpprecht • Reporter • Rudolf Augstein • Schicksal • Sergio Corbucci • Silvio Berlusconi • Toni Negri • Trauma • Wendepunkt |
| ISBN-10 | 3-462-30840-8 / 3462308408 |
| ISBN-13 | 978-3-462-30840-2 / 9783462308402 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich