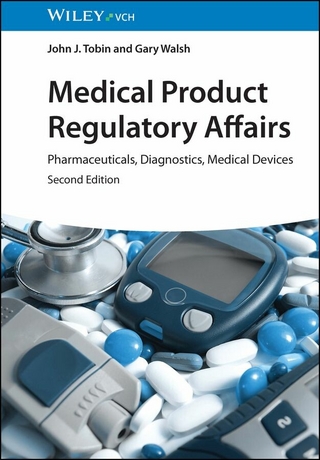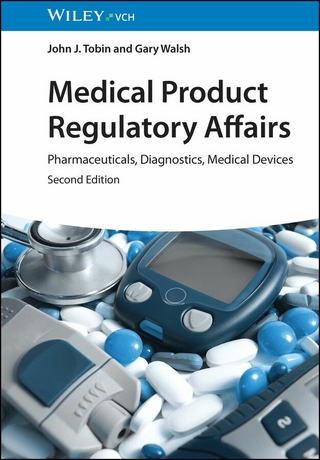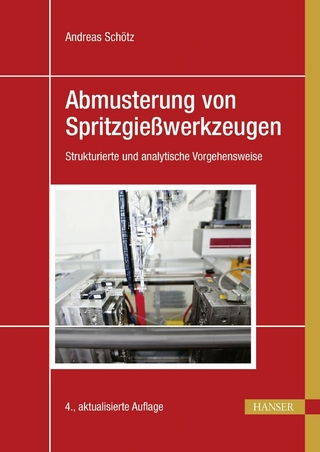Chemie für Einsteiger und Durchsteiger (eBook)

400 Seiten
Wiley-VCH (Verlag)
978-3-527-82091-7 (ISBN)
Kompakt und auf den Punkt gebracht sind alle Hauptthemen der anorganischen und organischen Chemie äußerst verständlich erklärt und abgedeckt. Dabei unterstützen besondere Textelemente Ihren Lernerfolg:
* Für inhaltliche Orientierung sorgen optisch hervorgehobene Schlüsselthemen am Kapitelanfang.
* Das Wichtigste wird kurz und prägnant in Definitionen und Merksätzen zusammengefasst.
* Beispiele helfen beim Anwenden des Lernstoffs.
* Wissenstest und Prüfungsvorbereitung: Aufgaben mit Lösungen helfen ungemein beim eigenständigen Überprüfen des Gelernten.
Thomas Wurm hat nach dem Pharmaziestudium und einer Promotion in Physiologie mehrere Jahre in der pharmazeutischen Industrie im Bereich analytische bzw. galenische Entwicklung, Zulassung und Projektmanagement gearbeitet. Im Anschluss wendete er sich der Ausbildung im Berufsfeld Pharmazie zu. Er unterrichtet seither an einer Berufsfachschule u.a. die Fächer Arzneimittelkunde und Chemie in Theorie und Praxis.
AUFBAU DER MATERIE, ATOMBAU UND PERIODENSYSTEM
Aufbau der Materie
Atombau
Das Periodensystem der Elemente (PSE)
Radioaktivität
REAKTIONSGLEICHUNGEN UND STÖCHIOMETRIE
Die Reaktionsgleichung
Umgesetzte Mengen und Massen
Die Stoffmenge Mol
Reaktionstypen in der Chemie
Konzentrationsangaben
Die Aktivität
Rechenbeispiele
Mischungsrechnen
BINDUNGSARTEN
Die Ionenbindung
Die Metallbindung
Die Elektronenpaarbindung
Mehrfachbindungen
Komplexbindung
Bindungskräfte zwischen Molekülen
KINETIK UND THERMODYNAMIK
Chemische Kinetik
Thermodynamik
Verbindungen zwischen Kinetik und Thermodynamik
ZUSTANDSFORMEN DER MATERIE
Die Aggregatzustände
Phasenübergänge
Lösungen
SÄUREN UND BASEN
Die Theorien von Arrhenius und Brönsted
Die Stärke von Säuren und Basen
Die Neutralisationsreaktion
Der pH-Wert
Puffer
REDOXREAKTIONEN
Die Reaktion von Metallen mit Sauerstoff
Verbrennung von Kohlenstoffverbindungen
Die Knallgasreaktion
Die Elektronenverteilung in Verbindungen
Oxidationszahlen
Häufig vorkommende Typen von Redoxreaktionen
Elementare Vorgänge bei Redoxreaktionen
Oxidations- und Reduktionsmittel
Das Aufstellen von Redoxgleichungen
Disproportionierung und Komproportionierung
Die Spannungsreihe der Metalle
Elektrochemie
SONDERSTELLUNG DES KOHLENSTOFFS
Die Stellung des Kohlenstoffs im PSE
Die Bildung von Hybridorbitalen
Kohlenwasserstoffe
Die Einteilung organischer Verbindungen: Funktionelle Gruppen
KOHLENWASSERSTOFFE
Alkane
Verzweigte Alkane
Alkene
Alkine
Aliphaten
Cyclische Kohlenwasserstoffe
Physikalische Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe
Chemische Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe
Aromatische Verbindungen
Erdöl und Kohle
Reaktionen der Aromaten
Halogenierte Kohlenwasserstoffe
ALKOHOLE
Einwertige Alkohole
Mehrwertige Alkohole
Primäre, sekundäre und tertiäre Hydroxylgruppen
Reaktionen von Alkoholen
Phenole
ALDEHYDE UND KETONE
Die Carbonylgruppe
Nomenklatur der Aldehyde
Nomenklatur der Ketone
Reaktionen der Carbonylgruppe
AMINE
Die Aminogruppe
Primäre, sekundäre und tertiäre Amine
Die Basizität der Amine
Quartäre Amine
Aromatische Amine
Reaktionen mit salpetriger Säure/Nitrit
Weitere stickstoffhaltige Verbindungen
CARBONSÄUREN
Die Carboxyl-Gruppe
Die homologe Reihe der Carbonsäuren
Physikalische Eigenschaften
Die Säurestärke
Substituierte Carbonsäuren
Derivate der Carboxyl-Gruppe
Typische Reaktionen von Carbonsäuren
REAKTIONSTYPEN IN DER ORGANISCHEN CHEMIE
Grundsätzliches
Additionen
Substitutionen
Eliminierung
Umlagerung
Redoxreaktionen
ISOMERIE
Konformationsisomerie
Strukturisomerie
Stereoisomerie
Optische Aktivität
KUNSTSTOFFE
Einteilung nach Materialeigenschaften
Halbsynthetische Kunststoffe
Vollsynthetische Kunststoffe
Silicone
NATURSTOFFE
Fette, Öle, Seifen, Wachse
Aminosäuren und Eiweiße
Kohlenhydrate
Nucleinsäuren
NOMENKLATURREGELN
LÖSUNGEN ZU FRAGEN
1
Aufbau der Materie, Atombau und Periodensystem
In diesem Kapitel … Haben Sie folgende Definition schon gehört? „Chemie ist’s dann, wenn’s qualmt und stinkt.“ Dabei geht man davon aus, dass sowohl der Qualm als auch die Duftnote neu entstanden sind, und zwar durch eine chemische Reaktion, also eine stoffliche Umsetzung. Somit beschäftigt sich die Chemie mit Reaktionen oder chemischen Umsetzungen; und darunter verstehen wir stoffliche Veränderungen. Wir sagen, Stoff A reagiert zu Stoff B, und symbolisieren dies durch den Reaktionspfeil „→“. Was aber ist ein Stoff? Woraus besteht die Materie? Klären wir zuerst einige Begriffe, um uns anschließend mit Atomen und ihrem Aufbau zu beschäftigen. Am Ende des Kapitels wollen wir noch auf den Zerfall von Atomkernen eingehen – ein Thema, das zwischen der Physik und der Chemie angesiedelt ist.
1.1 Aufbau der Materie
Nach unserem Verständnis ist Materie alles, was Raum einnimmt und eine Masse besitzt.
1.1.1 Reinstoffe
Reinstoffe kann man mit physikalischen Methoden wie Sortieren, Sieben, Filtrieren, Zentrifugieren, Destillieren nicht weiter auftrennen. Beispiele dafür sind Gold (ein Element), Sauerstoff (ein Element, welches in Form von Molekülen vorkommt) oder Wasser (eine Verbindung von zwei Elementen). Reinstoffe oder reine Substanzen können folglich Elemente oder chemische Verbindungen sein.
1.1.2 Mischungen
Eine Mischung besteht aus mehreren Reinstoffen und lässt sich mit physikalischen Methoden in ihre Bestandteile (die Reinstoffe) trennen.
Eine Mischung aus Schotter und Sand lässt sich durch Sortieren oder Sieben trennen. Eine Mischung aus Sand und Kochsalz lässt sich ebenfalls mit physikalischen Methoden trennen, indem man das Salz mit Wasser herauslöst. Eine Mischung aus Salz und Wasser trennt man, indem man das Wasser verdampft.
Abb. 1.1
Es gibt heterogene und homogene Mischungen. Heterogenen Mischungen sieht man es mit bloßem Auge an, dass sie aus mehreren Bestandteilen oder Phasen bestehen.
Bei einer homogenen Mischung sieht man das nicht, sie ist schließlich „homogen“ (gleichförmig). Man muss sie erst genauer untersuchen. Eine wässrige Kochsalzlösung sieht genauso aus wie der Reinstoff Wasser. Erst beim Abdampfen des Wassers (eine physikalische Methode) erkennen wir, dass ein nicht flüchtiger Rückstand verbleibt, der vorher unsichtbar, eben homogen hineingemischt war.
Wichtig zu wissen
Wir unterscheiden Reinstoffe und Mischungen. Mischungen können homogen und heterogen sein.
Tipp
Die analytische Chemie untersucht Mischungen und Reinstoffe, um Hinweise auf die genaue Zusammensetzung und die Identität der vorliegenden Substanzen zu erhalten. Sie bedient sich dabei chemischer und physikalischer Verfahren. Wo die Grenze zwischen Physik und Chemie liegt, ist dabei nicht immer eindeutig; man spricht dann von physikalisch-chemischen Methoden oder von physikalischer Chemie (der Begriff „chemische Physik“ ist weniger gebräuchlich).
1.1.3 Elemente und Verbindungen
Wichtig zu wissen
Elemente bestehen aus gleichartigen Atomen.
Elemente sind Reinstoffe.
Verbindungen sind ebenfalls Reinstoffe. Sie sind aus mehreren verschiedenen Atomsorten aufgebaut.
Die Atome sind in Verbindungen so miteinander verknüpft, dass physikalische Methoden nicht zur Auftrennung führen. Viele Verbindungen sind „Moleküle“, andere Verbindungen sind Salze; entscheidend ist der Bindungstyp (siehe Kapitel 3). Mithilfe von chemischen Reaktionen lassen sich Verbindungen jedoch in andere Verbindungen, eventuell auch in die beteiligten Elemente überführen.
1.2 Atombau
In diesem Abschnitt … Unter Atomen stellte sich der Grieche Demokrit vor über 2000 Jahren unteilbare Teilchen vor, aus denen sich die Materie zusammensetzt. Diese Idee wurde immer wieder diskutiert, verworfen und variiert. Letztlich hatte Demokrit recht, auch wenn die Atomphysik heute in der Lage ist, sogar Atome in immer kleinere Teilchen weiter aufzuspalten. Für chemische Überlegungen genügt es aber, wenn wir auf der Ebene eines Atoms bleiben und uns eine bildliche Vorstellung vom Atombau machen können. Wir entwickeln also gedanklich ein Atommodell.
Wichtig zu wissen
Jedes Atom besteht aus einem Kern, dem Atomkern, und einer Hülle, der Elektronenhülle.
1.2.1 Der Atomkern
Der Atomkern ist aufgebaut aus zwei Arten von Teilchen, die auf engstem Raum aneinanderkleben, nämlich den positiv geladenen Protonen (p+) und den Neutronen (n), die keine Ladung besitzen.
Die Schreibweise für diese Kernteilchen, die Nukleonen, lautet:
Proton: 1p+
Neutron: 1n
Tipp
Die hochgestellte Ziffer links steht für die Masse des Teilchens (s. u.); man kann sie auch weglassen. Rechts oben steht die Ladung.
Es muss einen Chemiker nicht unbedingt interessieren, dass die moderne Physik nach immer kleineren Bestandteilen sucht, die ihrerseits die Protonen und die Neutronen aufbauen. Je intensiver die Physiker suchen und je mehr Energie sie aufwenden, desto mehr und desto kleinere Teilchen scheinen sie zu finden. Es ist – zumindest derzeit – unklar, ob der auf diese Weise aufgebaute „Teilchenzoo“ jemals vollständig und endgültig sein kann.
Der einfachste Atomkern mit der Ordnungszahl 1 besteht aus genau einem Proton p+. Es handelt sich um das Element Wasserstoff.
Abb. 1.2
Der nächste Atomkern mit der Ordnungszahl 2 besteht aus zwei p+ und heißt Helium. In der Regel enthält ein Heliumkern neben den zwei p+ auch noch zwei Neutronen n.
Es folgt mit der Ordnungszahl 3 ein Kern mit drei Protonen, Lithium; hinzu kommen vier Neutronen im Kern, also hat ein Lithiumkern insgesamt sieben Nukleonen.
Diese Reihe können wir bis zu 90 und mehr Protonen fortsetzen. Bei 92 p+ sind wir beim Uran angelangt; das sind dann alle natürlich vorkommenden Atomtypen (alle natürlichen Elemente).
Wichtig zu wissen
Der Atomtyp (das Element) ist definiert durch die Anzahl der Protonen p+. Alle p+ befinden sich im Kern.
Für die Anzahl an p+ kann man auch den Begriff Ordnungszahl benutzen.
Jeder Ordnungszahl wird eine Elementbezeichnung und ein Kürzel oder Elementsymbol zugeordnet.
„H“ steht beispielsweise für Wasserstoff, „He“ für Helium, „Li“ für Lithium usw.
Die Anzahl der Neutronen n ist für die Zugehörigkeit zu einem Element ohne Bedeutung.
1.2.1.1 Die Atommasse
Wir können an dieser Stelle einen ersten orientierenden Blick auf die Masse eines Atoms werfen. Die Elektronen e− sind im Vergleich zu den p+ und n sehr leicht; wir wollen sie zunächst in unseren Berechnungen unterschlagen und bleiben bei den Kernen.
Wichtig zu wissen
Die Massen eines Protons und eines Neutrons sind nahezu gleich.
In Gramm ausgedrückt ist diese Masse sehr, sehr klein und für unseren Zweck, nämlich die bildhafte Erklärung eines Atoms, viel zu unhandlich. Sie beträgt 1,67 × 10–24g. Daher setzen wir die Masse eines Protons und eines Neutrons einfach gleich 1. Als Einheit nehmen wir „u” – von „atomic mass unit”.
Damit hat das normale Wasserstoffatom die Masse 1 u, Helium hat die Masse 4 u (da sein Kern normalerweise aus 2 p+ und 2 n besteht), Lithium hat 7 u (3 p+ und 4 n), und Kohlenstoff hat 12 u (6 p+ und 6 n).
Abb. 1.3
Der Chemiker schreibt in seiner Formelsprache 1H, 4He, 7Li und 12C.
Wichtig zu wissen
Die Zahl links oben ist die Massenzahl MZ.
Die Zahl links unten ist die Ordnungszahl OZ (oder Protonenzahl).
Beispiele:
Die Angabe der Ordnungszahl bringt keine zusätzliche Information, da das Elementsymbol bereits für den Atomtyp und damit die Ordnungszahl steht. Meistens wird die Ordnungszahl deshalb weggelassen.
Die Differenz aus Massenzahl und Ordnungszahl ergibt die Anzahl der Neutronen, wenn man sie denn wissen möchte.
1.2.1.2 Isotope
Spannend ist die Tatsache, dass nur wenige Atomtypen in der Natur als eine Kernsorte mit einer festen Zahl an Neutronen auftreten. Innerhalb eines Elements gibt es meist eine Mischung von Kernen, wobei die Anzahl p+ natürlich gleich sein muss; die Protonen umgeben sich also mit unterschiedlich vielen Neutronen.
Somit treten Subtypen innerhalb eines Elements auf, sogenannte Isotope. Da deren Mischungsverhältnis praktisch überall auf der Welt identisch ist, führt uns dieser Sachverhalt zur (durchschnittlichen) Massenzahl MZ einer Atomsorte und damit zur Atommasse eines Elements. Die Kohlenstoffkerne treten beispielsweise zu 98,9 % mit 6 n auf, was die MZ 12 ergibt. Enthält der C-Kern aber 7 n, was für 1,1 % der C-Kerne zutrifft, führt das zu der MZ 13. Man spricht von einem C-13-Isotop oder 13C-Kohlenstoff.
Tipp
In ganz geringem Umfang taucht auch noch 14C-Kohlenstoff auf, der in der höheren Atmosphäre unter dem Einfluss von Strahlung entsteht. Dieser Kern ist aber instabil und zerfällt wieder von selbst. Wir haben es hier mit einem Beispiel...
| Erscheint lt. Verlag | 25.2.2019 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Naturwissenschaften ► Chemie |
| Schlagworte | Anorganische Chemie • Chemie • Chemie f. Gesundheitsfachberufe • Einführung in die Chemie • Organische Chemie |
| ISBN-10 | 3-527-82091-4 / 3527820914 |
| ISBN-13 | 978-3-527-82091-7 / 9783527820917 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,8 MB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich