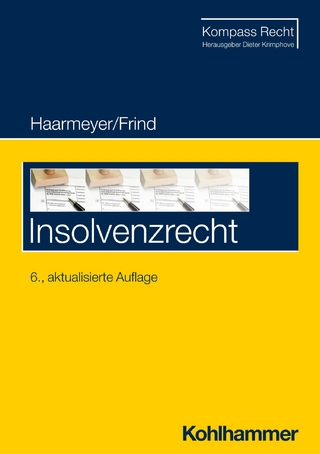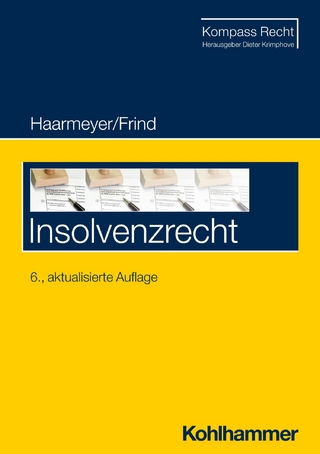Abwicklungs- und Verteilungsprobleme bei massenhaft streitigen Insolvenzforderungen im Insolvenzverfahren (eBook)
248 Seiten
Tectum-Wissenschaftsverlag
978-3-8288-6619-5 (ISBN)
Cover 1
Übersicht 6
Inhaltsverzeichnis 8
Abkürzungsverzeichnis 16
Einführung 20
A.Themenaufriss und Rechtfertigung 20
B.Gang der Untersuchung Ziele der Arbeit
Kapitel 1:Die Rechtsprobleme am praktischen Fall 28
A.Der Fall Phoenix: Geschäftsmodell und Ursachen der Insolvenz 28
B.Konflikte 31
I.Zusammenspiel von Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckungsrecht 31
1.Insolvenzrecht als besondere Form der Zwangsvollstreckung 31
2.Unterschiede zum Zwangsvollstreckungsrecht 33
II.Klassifizierung und Bestimmung der Gläubigerforderungen 36
1.Aussonderung durch Treuhandabrede? 37
2.Eine Forderung, mehrere Berechnungsmethoden 40
Kapitel 2:Abwicklungs- und Verteilungshindernisse bei massenhaft streitigen Insolvenzforderungen im Regelverfahren 46
A.Die Forderung als Schlüssel der Gläubigerrechte: Ein Überblick 46
I.Antragsrecht aufgrund des persönlichen Leistungsanspruchs 46
II.Die spezifischen (Insolvenz-)Gläubigerrechte 46
1.Teilnahmerecht 47
2.Informations- und Anwesenheitsrecht 48
3.Mitbestimmungsrecht 49
4.Teilhaberecht 52
5.Prüfungsrecht 52
6.Vollstreckungsrecht aus der Tabelle 53
III.Zwischenergebnis 53
B.Abwicklungshindernisse 54
I.Tabellenführung 55
II.Stimmrechte in Gläubigerversammlungen 55
1.Grundsätze für Abstimmungen 56
2.Gefährdung der Gläubigerautonomie bei massenhaft streitigen Forderungen 58
C.Verteilungshindernisse bei unbestimmbarer Passivmasse 59
I.Das „Phoenix-Szenario“ – Der Wunsch einer frühzeitigen Vermögensverteilung 59
II.Grundsätze für Verteilungen im Regelverfahren 60
1.Überblick über Verteilungswege 60
2.Berücksichtigung festgestellter und bestrittener Forderungen 61
3.Blick in die Praxis und auf den Ausgangsfall 62
III.(Unzureichende) Korrektur- und Einflussnahmemöglichkeiten 63
1.Möglichkeiten des Gerichts 63
2.Möglichkeiten der Gläubiger 65
a)Einigung nach Widerspruch 66
b)Die Gläubigerversammlung: geeignetes Forum zur Vergemeinschaftung der Gläubigerinteressen? 66
c)Reichweite der Befugnisse 68
3.Möglichkeiten des Insolvenzverwalters 69
a)Einflussmöglichkeiten auf das Anmeldeverfahren 69
aa)Pool- oder Sammelanmeldungen 69
bb)Automatisierter Anmeldeprozess 71
b)Einflussmöglichkeiten im Feststellungsverfahren durch individuelle Vergleiche 72
4.Doch eine Abschlagsverteilung? 73
a)Problem: Rückstellungen als unkalkulierbarer Unsicherheitsfaktor 73
b)Problem: Haftungsrisiko durch ungerechte Verteilung 75
c)Problem: Verteilungen (nur) im Ermessen des Insolvenzverwalters 77
D.Problemexkurs: Sanierungshindernis 77
E.Zwischenergebnis 79
Kapitel 3:Neue Ansätze? Ein Blick über den insolvenzrechtlichen „Tellerrand“ 82
A.Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) 82
I.Anwendungsbereich 83
II.Schranke des § 240 ZPO 84
III.Unbrauchbarkeit des Rechtsgedankens 85
B.Allgemeines Verfahrensrecht 85
Kapitel 4:Der Phoenix-Plan: Begrenzte Autonomie im Planverfahren 88
A.Der gescheiterte verfahrensbegleitende Phoenix-Insolvenzplan 88
I.Einführung 88
II.Ziel, Motiv und Regelungsgehalt 88
III.Insolvenzspezifische Einordnung 90
1.Plantypen 90
2.Zulässigkeit der verfahrensbegleitenden Wirkung 92
3.Anwendungsbereich, einheitlicher Terminus technicus? 94
B.Der Phoenix-Plan auf dem Prüfstand der Gerichte 96
I.Landgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 29.10.2007 97
II.BGH, Beschluss vom 5.2.2009 98
III.Zwischenergebnis 99
Kapitel 5: Untersuchung der Planfestigkeit der §§ 174 ff. InsO 100
A.Ziel 100
B.Prüfungsreihenfolge 101
C.Keine Spezialvorschrift 101
D.§ 217 InsO: Das Schlüsselbrett und Tür zur Privatautonomie 106
I.Ausgangspunkt und Maßstab der Überlegungen 106
II.Wortsinn und systematische Interpretation 109
1.Das Anmelde- und Feststellungsverfahren als Teil der Befriedigung? 110
2.Das Anmelde- und Feststellungsverfahren als Teil der Verteilung? 112
3.Das Anmelde- und Feststellungsverfahren als Teil der Verfahrensabwicklung? 113
III.Historische Ansätze 113
1.Der Insolvenzplan im Reformprozess 114
2.Reformbemühungen und ökonomisch geprägte Einflüsse und Gesichtspunkte 116
3.Gläubigerautonomie im Spannungsfeld von zwingenden Vorschriften 119
4.Die Entwicklungsgeschichte: das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) 122
IV.Der Sinn und Zweck 124
1.Die „konturenlose“ Gläubigerautonomie und die Macht der Mehrheit 125
2.Keine Gefahr einer fehlerhaften Bewertung 128
3.Bedeutung der Tabelle im Regel- und Planverfahren 129
4.Ein Blick zu den USA – Das Vorbildargument? 134
5.Gläubiger(un-)gleichbehandlung 135
6.Ordnungsfunktion des Anmelde- und Feststellungsverfahrens 136
7.Das Argument der Nachrangigkeit 138
V.Bestätigung durch verfassungskonforme Auslegungskontrolle 139
E.Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse 142
Kapitel 6:Die Suche geht weiter! Grundlagen alternativer Plangestaltungen –das Problem der Stimmrechte 144
A.Notwendigkeit einer gesicherten Stimmrechtsregelung 144
B.Verfahren (§ 235 InsO) 145
C.Bestimmung von Stimmrechten im Planverfahren 146
I.Stimmrechte für unbestrittene Insolvenzforderungen 146
II.Stimmrechte für bestrittene Insolvenzforderungen 147
1.Das Einigungsverfahren 148
2.Die gerichtliche Stimmrechtsentscheidung 149
a)Zuständigkeit, Kontrolle 150
b)Maßstäbe und Kriterien der Entscheidung 150
c)Ansätze bei massenhaft streitigen Forderungen 151
d)Unterstützung durch den Insolvenzverwalter 152
3.Vergleichbares Modell nach US amerikanischem Recht: Rule 3018 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure 153
4.Kritikpunkt – Mögliche Überforderung der deutschen Insolvenzgerichte 154
a)Sachkunde der Insolvenzrichter 155
b)Zuständigkeit der Insolvenzgerichte 155
D.Ergebnis 157
Kapitel 7:Gestaltungsversuche über Options- und Verteilungspläne: Die zulässige „Bestimmung“ von Gläubigerforderungen für Sanierungs- und Verteilungszwecke 158
A.Vorüberlegungen: Das „Phoenix-Erbe“ 158
I.Wirkungskreis und Beteiligung der Gläubiger 158
II.Die Herausforderung: Bindung und Schutz der Gläubiger 159
B.Vorschlag 1: Der Optionsplan 161
I.Idee und These: Handlungsoptionen auf Vergleichsangebote 161
II.Erläuterungen des Gesamtkonzeptes 163
1.Grundlagen der Überlegungen und Behauptung 163
2.Der Vergleich mit optionalem Widerspruchsrecht 164
a)Der Berechnungsmodus (nur) als Vergleichsvorschlag 164
b)Das Widerspruchsrecht: Inhalt, Ablauf, Zeitpunkt 164
c)Das Wahlrecht als Opt-Out-Modell 166
aa)Vorüberlegungen 166
bb)Konkludenz des Schweigens als zulässiger Planinhalt (§§ 231, 250 InsO) 167
1)Formelle Zulässigkeit 167
2)Materielle Zulässigkeit 168
2a)Exkurs: Schweigen im Vertragsrecht 169
2b)Wesen des Insolvenzplans als ein dem Vertrag bürgerlichen Rechts ähnliches Rechtsinstitut 170
2c)Prinzip bei Passivität im Insolvenzverfahren: Eine Abwägungen der Interessen 174
3)Zwischenergebnis 177
cc)Ablehnung durch Widerspruch 177
d)Ermächtigung des Insolvenzverwalters (§ 160 InsO) 178
e)Gedankenexkurs: Opt-In-Modell für Aussonderungsberechtigte (Phoenix)? 179
3.Korrektur der Insolvenztabelle 181
4.Durchführung der Verteilung 181
a)Rückgriff auf die Insolvenztabelle 181
b)Berücksichtigung der ablehnenden Gläubiger 182
c)Berücksichtigung von Nachzüglern 183
d)Gestaltungsalternative: Plandispositivität des § 192 InsO? 184
III.Verfahrensfragen 186
1.Planvorlagerecht (§ 218 InsO) 186
2.Verfahrensbegleitende Wirkung? 186
3.Planbestätigung 187
a)Gerichtliche Überprüfung (§§ 231, 250 InsO) 188
b)Minderheitenschutz: Die insolvenzrechtliche Wertgarantie (§ 251 InsO) 189
IV.Zusammenfassung 191
C.Vorschlag 2: Der tabellenunabhängige Verteilungsplan 192
I.Kritik am Optionsplan und die Notwendigkeit einer Alternative 192
II.Idee und These: Forderungsschätzung für Zwecke der Verteilung 193
1.„claim estimation“ nach amerikanischem Vorbild 193
2.Übertragbarkeit und Anwendung des Rechtsgedankens 197
IV.Der Beweis der These: Die Insolvenztabelle im Regel- und Planverfahren 199
1.Ausgangspunkt der Überlegungen 200
2.Tabellenfunktionen im Regelverfahren 200
a)Einfluss und Bedeutung für das Mitbestimmungsrecht 201
b)Einfluss und Bedeutung für das Teilhaberecht 201
aa)Anmeldung und Feststellung zur Tabelle 201
bb)Das Verteilungsverzeichnis als fortgeschriebene Tabelle 203
cc)Umgang mit bestrittenen Forderungen 204
dd)Korrektur des Verteilungsverzeichnisses vor Verteilung 205
ee)Kein unmittelbarer Zahlungsanspruch 206
c)Einfluss und Bedeutung für das Vollstreckungsrecht 206
d)Zwischenergebnis 207
3.Tabellenfunktionen im Planverfahren 207
a)Einfluss und Bedeutung für das Mitbestimmungsrecht 208
b)Einfluss und Bedeutung für das Teilhaberecht 208
aa)Zulässigkeit einer tabellenunabhängigen Verteilungsregel 209
1)Auslegung des § 217 S. 1 InsO 209
2)Identische Tabellenquote, jedoch unterschiedliche Gruppenquote 210
3)Gegenstand und Wirkung der Tabelleneintragung 211
4)Gerechtigkeit durch Verhandlung im Regel- aber auch im Planverfahren 213
5)(Un-)berechtigte Zahlungen auf (titulierte) Forderungen 214
6)Risiko einer fehlerhaften Verteilungsregel hinnehmbar 216
7)Bekannte Gläubiger (§ 229 S. 3 InsO) 218
8)Allgemeine Wirkung des Plans (§ 254 Abs. 1 InsO) 218
bb)Kritik 219
1)Spezialgesetzliche Regelung des § 256 InsO? 220
2)Durchführung des allgemeinen Prüfungstermins 220
3)Vorläufigkeit (k)ein Prinzip des Insolvenzverfahrens? 221
4)Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG? 222
cc)Ergebnis 223
c)Einfluss und Bedeutung für das Vollstreckungsrecht (§ 257 InsO) 224
4.Fazit 226
V.Umsetzungs- und Verfahrensfragen 227
1.Beispielhafte Verteilungsregel durch Schätzung von Verbindlichkeiten 227
a)Grundsatz I: „Alles“ oder „Nichts“ 227
b)Grundsatz II: Inhaltsoffenheit und Fairnessgebot 228
c)Die homogene Schuldenmasse 228
d)Die inhomogene Schuldenmasse 228
2.Die Festlegung einer Zielverschuldung (§§ 224, 255 f. InsO) 230
a)Grundlagen 230
b)Liquidation 232
c)Sanierung 233
3.Gruppenbildung 234
a)Sinn und Zweck im Konflikt zu Manipulationsmöglichkeiten 234
b)Unzulässigkeit oder Gebotenheit zur Bildung eigener Gruppen der Gläubiger mit streitbefangenen Forderungen? 236
4.Verfahrensbegleitende Wirkung (§ 258 Abs. 1 InsO) 238
5.Planbestätigung 239
a)Gerichtliche Überprüfung (§§ 231, 250 InsO) 239
aa)Ausgangspunkt und grundlegende Bedeutung des Widerspruchsrechts 239
bb)Keine Einschränkung der Verfahrensrechte (§ 178 InsO) 240
b)Minderheitenschutz: Die insolvenzrechtliche Wertgarantie (§ 251 InsO) 242
aa)Grundlagen 242
bb)Prognose der Schlechterstellung 244
cc)Quotenschaden als potenzielle Schlechterstellung 245
1)„mittelbarer“ und „unmittelbarer“ Quotenschaden 246
2)Ausgleich durch bereitgestellte Mittel (§ 251 Abs. 3 InsO) 247
2a)Anspruchsberechtigte 248
2b)Geltendmachung, Höhe der Ausgleichsmittel 249
dd)Ergebnis: Wahrung und Schutz der Parteiinteressen 250
Fazit: Erinnerungen an die wichtigsten Erkenntnisse und Ausblick 252
Anlagen 254
A.Anlage 1: Rechenbeispiel für Rückstellungen 254
B.Anlage 2: Rechenbeispiel für Verteilungsungerechtigkeit 256
C.Anlage 3: Rechenbeispiel für mögliche Schlechterstellung 258
Ausgangspunkt 260
Regelverfahren 260
Planverfahren 260
Literaturverzeichnis 262
| Erscheint lt. Verlag | 16.1.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag |
| Verlagsort | Baden-Baden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Privatrecht / Bürgerliches Recht |
| Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Insolvenzrecht | |
| Schlagworte | Gläubigerforderungen • Gläubigerrechte • InsO • Insolvenzforderungen • Insolvenzordnung • Insolvenzplan • Insolvenzrecht • Insolvenzverwaltung • Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz • KapMuG • Phoenix Kapitaldienst GmbH • Zwangsvollstreckungsrecht |
| ISBN-10 | 3-8288-6619-0 / 3828866190 |
| ISBN-13 | 978-3-8288-6619-5 / 9783828866195 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 479 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich