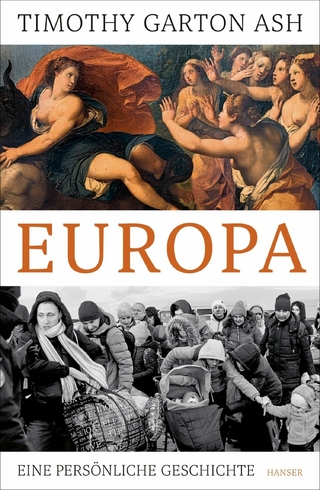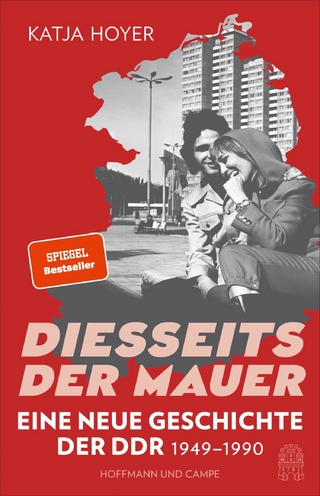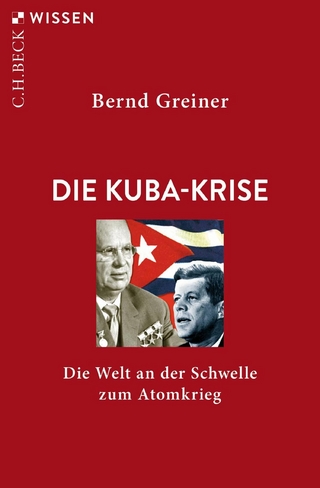Leben mit Auschwitz (eBook)
256 Seiten
Gütersloher Verlagshaus
978-3-641-25947-1 (ISBN)
2020 jährt sich der Tag der Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal. Seit 75 Jahren müssen Überlebende und deren Nachfahren, muss die Welt, müssen die Deutschen mit dem Zivilisationsbruch leben, den der Name 'Auschwitz' markiert. Das Buch folgt dieser Geschichte.
Die Überlebenden des Holocaust konnten über das Geschehene oft nicht sprechen. Doch die Traumata des Erlittenen wirkten auch im Stillen und gerade dort: Überlebende und ihre Kinder beschwiegen das Unfassbare, um einander zu schützen und dem Schrecken nicht oder nicht noch einmal begegnen zu müssen.
Anders die Generation der Enkel. Sie stellt den Großeltern nicht nur Fragen, auf die sie auch Antworten bekommt. Sie erlebt Auschwitz zudem als ein historisches Faktum, das in den 75 Jahren, die seit der Befreiung des Lagers vergangen sind, beschrieben und analysiert, interpretiert und bearbeitet wurde. Was aber heißt und bedeutet Auschwitz dann für diese Dritte Generation?
Dieses Buch versammelt Zeugnisse von Enkelinnen und Enkeln von Auschwitz-Überlebenden. Es sind oft berührende, manchmal erschütternde und immer nachdenkenswerte Berichte darüber, wie wirkmächtig das Geschehen von damals im Leben von Menschen auch heute noch ist. Auschwitz war nicht nur gestern, Auschwitz ist heute - immer noch und bleibend.
- Wegmarken der Wahrnehmung von Auschwitz "nach Auschwitz"
- Geschichten hinter der Geschichte
Andrea von Treuenfeld, hat in Münster Publizistik und Germanistik studiert und nach einem Volontariat bei einer überregionalen Tageszeitung lange als Kolumnistin, Korrespondentin und Leitende Redakteurin für namhafte Printmedien, darunter Welt am Sonntag und Wirtschaftswoche, gearbeitet. Heute lebt sie in Berlin und schreibt als freie Journalistin Porträts und Biografien. Im Gütersloher Verlagshaus erschienen bereits ihre Bücher 'In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel', 'Zurück in das Land, das uns töten wollte', 'Erben des Holocaust', 'Israel. Momente seiner Biografie' und 'Leben mit Auschwitz'.
Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz
Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Drei Tage später nahmen deutsche Truppen die im Süden des Landes gelegene Stadt Oświęcim ein und gaben ihr wieder den Namen, den sie bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts getragen hatte: Auschwitz.
Drei Kilometer von ihrem Zentrum entfernt war bereits zwei Jahrzehnte zuvor ein Lager für Saisonarbeiter entstanden. Heinrich Himmler*, auf der Suche nach einem geeigneten Gelände für ein weiteres Konzentrationslager, entscheidet sich für dieses Areal, trotz der zerfallenen Häuser und Holzbaracken. Mit seiner Anbindung an die Bahnstrecke Wien-Krakau und der abgeschotteten Lage entspricht es genau den Vorstellungen des Reichsführers SS, und am 27. April 1940 befiehlt er die dortige Errichtung des Konzentrationslagers Auschwitz. Nach mehreren kleinen Lagern, darunter auch Oranienburg (März 1933) und Esterwegen (Sommer 1933), die meist nach wenigen Monaten wieder aufgelöst wurden, sowie Dachau (März 1933), Sachsenhausen (Juli 1936), Buchenwald (Juli 1937), Flossenbürg (Mai 1938), Mauthausen (August 1938), Neuengamme (Dezember 1938), Ravensbrück (April 1939), Stutthof (September 1939) wird es das größte von den Nationalsozialisten errichtete Lager dieser Art werden: gedacht, zumindest anfangs, für die Festsetzung sogenannter »unerwünschter Elemente«.
Der Posten des Standortkommandanten fällt Rudolf Höß* zu, der schon in Dachau und in Sachsenhausen an exponierter Stelle seinen Dienst versehen hat. Angeblich ist es seine Idee, über dem Lagertor den zynischen Spruch »Arbeit macht frei« anbringen zu lassen, eine Inschrift, die schon in einigen anderen Lagern über den Eingang montiert wurde.
Am 20. Mai 1940 kommen die ersten Deportierten: dreißig deutsche sogenannte »Kriminelle«, unter ihnen Bruno Brodniewicz, der nicht nur der erste Lagerälteste wird, sondern auch die Nummer 1 erhält – und wegen seiner Grausamkeit anderen Inhaftierten gegenüber den Beinamen »Der schwarze Tod«. Im Juni trifft ein Transport mit 728 politischen Gefangenen ein, durchweg Polen, wie auch die Häftlinge der nachfolgenden Transporte. Sie alle sind dazu bestimmt, in Zwangsarbeit den Auf- und Ausbau des Lagers voranzutreiben.
Denn das KL Auschwitz, wie es offiziell heißt, wächst schnell. Angelegt wird es zunächst auf 10.000 Gegner des NS-Regimes. Neben dem Häftlingslager, in NS-Sprache »Schutzhaftlager«, entstehen Werkstätten und Landwirtschaft, Wirtschaftsgebäude und Siedlungen für die Wachmannschaften und ihre Familien. Bereits Ende des Jahres umfasst das sogenannte »SS-Interessengebiet« vierzig Quadratkilometer, umgeben von Stacheldraht und Wachtürmen.
Am 1. März 1941 besucht Heinrich Himmler erstmals Auschwitz und befiehlt Rudolf Höß den weiteren Ausbau: Die Zahl der aufzunehmenden Inhaftierten soll sich verdreifachen. Nicht sicher ist, ob bei dieser Gelegenheit oder erst später der Befehl an den Kommandanten ergeht, ein weiteres Lager zu errichten. Im Herbst desselben Jahres wird jedenfalls das nahe gelegene Dorf Brzezinka, zu Deutsch Birkenau, zerstört. Auf seinem Boden entsteht nach dem Stammlager Auschwitz I das KL Auschwitz II – ein gigantisches, von sowjetischen Zwangsarbeitern in großer Eile errichtetes Barackenlager.
Für seine Architektur ist ausgerechnet ein Schüler des von den Nationalsozialisten verbotenen Bauhaus verantwortlich. Der Österreicher Fritz Ertl, Mitglied der NSDAP und der SS, setzt sein in Dessau erlangtes Wissen in Auschwitz-Birkenau um und entwirft neben gemauerten Baracken auch fensterlose Holzställe, karg und funktional, in die bis zu 750 Menschen einquartiert werden. Unter ständigem Hunger und primitivsten Bedingungen – auf den dreistöckigen Holzpritschen teilen sich mehrere Häftlinge einen Schlafplatz, Waschmöglichkeiten und Latrinen sind anfangs nicht vorhanden, Läuse und Ratten vermehren sich ungehemmt, Epidemien sind die Folge – wird hier das vom Berliner Reichssicherheitshauptamt beabsichtigte massenhafte Sterben zur Normalität.
Unter der Leitung des Chefs des RSHA, Reinhard Heydrich*, beschließen am 20. Januar 1942 auf der später so bezeichneten »Wannsee-Konferenz« fünfzehn hochrangige Mitglieder der NSDAP und der SS die »Endlösung der Judenfrage«: Synonym für die geplante Deportation und Vernichtung der elf Millionen europäischen Juden.
Ab Frühjahr 1942 treffen dann auch die ersten Massentransporte in Auschwitz ein. Bei der Selektion als »arbeitsfähig« aussortierte Menschen werden nicht sofort getötet, sondern registriert. Nachdem ihnen – wie auch jenen, die direkt nach ihrer Ankunft umgebracht werden – das Gepäck schon bei dem Heraustreiben aus den Viehwaggons, in denen sie tagelang, manchmal auch wochenlang unterwegs waren, von den SS-Wachmannschaften genommen wird, müssen sie sich ausziehen und duschen, desinfizieren und am ganzen Körper rasieren lassen. Ihre eigene Kleidung wird ausgetauscht gegen die blaugrau-gestreifte der Häftlinge, Schuhe sind ab jetzt sommers wie winters klobige Holzpantinen.
Ab Mitte 1942 wird Juden und ein halbes Jahr später auch allen anderen Deportierten – davon verschont bleiben nur die sogenannten »Reichsdeutschen« – eine Nummer auf den linken Unterarm tätowiert. Eine Schikane, die in keinem anderen KZ praktiziert wird. Selbst im Lager geborene Babys und Kleinkinder werden, sofern man sie nicht sofort tötet, dieser schmerzhaften Prozedur unterzogen. Weil ihr Unterarm zu klein ist, kennzeichnet man sie auf dem Oberschenkel.
Zur weiteren Kennzeichnung oder Unterscheidung werden farbige Dreiecke, »Winkel«, ausgegeben, die mit der Spitze nach unten auf Brusthöhe aufgenäht werden müssen. Gelb steht für Juden, rot für politische Gefangene, grün für Kriminelle, schwarz für »Asoziale«, zu denen zeitweise auch Sinti und Roma zählen, lila für Zeugen Jehovas, im Nazi-Jargon Bibelforscher genannt, rosa für Homosexuelle. Zusätzlich gibt ein Buchstabe Auskunft über das Herkunftsland.
In der Hierarchie der sogenannten »Häftlingsselbstverwaltung« sind es meist die »Grünen«, die, von der SS bestimmt und somit zu ihren direkten Handlangern gemacht, als Lagerälteste das Sagen haben und Privilegien wie einen eigenen Schlafraum, größere Essensmengen und bessere Kleidung genießen. Ihnen unterstellt sind die Blockältesten und denen die Stubenältesten. Arbeiten innerhalb und außerhalb des Lagers beaufsichtigen Kapos*.
Der Lager-Alltag ist in erster Linie ein Überlebenskampf. Morgens und abends oftmals stundenlang auf dem Appellplatz stehen, in Kolonnen zur Arbeit in Kiesgruben oder Werkhöfen marschieren, bis zur totalen Erschöpfung und auch bei gefährlichen Tätigkeiten ohne jeglichen Schutz viele Stunden körperliche Arbeiten leisten, auf dem Rückweg die Toten des Tages zurückschleppen, zu essen gibt es dünne Wassersuppe und wenig, meist schon verschimmeltes Brot. Begehrt sind die Schichten in der Näherei, in der Verwaltung, in der Küche sowieso und in »Kanada« – von den Häftlingen so genannt, weil es in ihren Vorstellungen das Land des Luxus und des Überflusses ist. Tatsächlich findet sich in diesem riesigen Depot alles, was die Häftlinge nicht haben: Kleidung, Wertsachen und Lebensmittel, gestohlen den Menschen, die längst »durch den Kamin gegangen sind«, wie es in der Lagersprache heißt. Ungeachtet des Verbots aus Berlin bedient sich die SS hier, allen voran Rudolf Höß, der auf diese Weise auch seine in der Villa neben dem KZ-Gelände wohnende Familie versorgt. Die meisten dieser Güter werden jedoch ins Reich geschickt. Ebenso wie das zu Barren gegossene Gold der herausgebrochenen Zähne der Leichen und die Tonnen Haare, die als Füllmaterial für Matratzen verwendet werden.
Bestrafungen für willkürlich beanstandete »Vergehen« der Häftlinge sind vielfältig und eine grausamer als die andere. Prügel, Folter, Strafexerzieren, was eine stundenlange Tortur von Kniebeugen, Rennen oder Kriechen bedeutet, Versetzung in die Strafkompanie, in der die Häftlinge bei schwerster Arbeit und unter Schlägen meist zu Tode geschunden werden. Oder aber auch Arrest in Block 11. Der sogenannte »Todesblock« ist eine der Backstein-Baracken im Stammlager, in dessen Keller das Gefängnis, der »Bunker«, untergebracht ist. Tausende von Häftlingen, die die Dunkel- oder Stehzellen sowie die Misshandlungen durch die Wachmannschaften noch überstehen, werden anschließend vor der »Schwarzen Wand« erschossen, die Block 10 und Block 11 verbindet. Nach der Befreiung des Konzentrationslagers wird es die Stelle sein, an der man auch Jahrzehnte später immer wieder Kränze niederlegt.
In diesem Kellergefängnis sterben Ende 1941 bei einem »Probeeinsatz« des Insektizides Zyklon B etwa 850 Inhaftierte, die meisten von ihnen sowjetische Kriegsgefangene. Das Blausäuregas, das anfangs tatsächlich zur Schädlingsbekämpfung verwendet wird, wirkt schon in geringen Mengen tödlich. Um das Morden effektiver zu gestalten – die Mehrheit der deportierten Menschen, etwa achtzig Prozent, wird bei den Selektionen als »nicht arbeitsfähig« eingestuft und geht den direkten Weg in den Tod –, werden die Vergasungen in das nun abgedichtete Krematorium (später Krematorium I) verlegt, wo die Leichen anschließend eingeäschert werden.
In Auschwitz-Birkenau dienen erst das »rote Haus« mit einem Fassungsvermögen von 800 Personen, dann auch das »weiße Haus« mit einem Volumen von 1200 Personen als provisorische Gaskammern. Die darin Ermordeten werden in Massengräber geworfen oder verbrannt. Im Sommer 1943 ersetzt man diese ehemaligen Bauernhöfe durch die vier neugebauten großen Krematorien (II-V). Sie sind ausgestattet...
| Erscheint lt. Verlag | 20.1.2020 |
|---|---|
| Vorwort | Kurt Grünberg |
| Verlagsort | Gütersloh |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |
| Schlagworte | Anne Frank • Aufklärung • Auschwitz • Befreiung Auschwitz • bittere brunnen • eBooks • Erbe Deutschlands • Geschichte • Geschichte Deutschland • Holocaust • Ich war das Mädchen aus Auschwitz • Judenverfolgung • Konzentrationslager • KZ • Nazideutschland • NS Deutschland • Tova Friedman • Versuche, dein Leben zu machen • Wider das Vergessen |
| ISBN-10 | 3-641-25947-9 / 3641259479 |
| ISBN-13 | 978-3-641-25947-1 / 9783641259471 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich